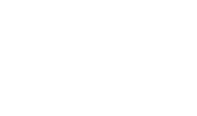Einzelvorträge: Faszination Wissenschaft

Prof. Dr. Clemens Wöllner
(Professor für Systematische Musikwissenschaft / Freiburger Forschungs- und Lehrzentrum Musik (FZM), Hochschule für Musik Freiburg)
Was hören wir, wenn wir Musik hören?
Zur Wahrnehmung von Form und Gestaltprinzipien in der Musik
Donnerstag | 23.10.25 | 20 Uhr c.t. | HS 1015
 Beim bewussten Hören von Musik erleben viele Menschen Verknüpfungen von Klängen, die kleinere und größere Strukturen bilden, vom musikalischen Motiv bis hin zu Symphoniesätzen. Für die Komposition und Musiktheorie sind diese Strukturen von besonderer Relevanz. So wird zum Beispiel die Anzahl der Takte oft genau gezählt und mitunter in Verbindung mit Zahlen als Bedeutungsträger gebracht. Gilt dies aber auch normativ für das Musikhören? Hören wir nur dann adäquat, wenn wir das Seitenthema in der Durchführung als solches erkennen? Der Vortrag führt in die Psychologie der Musikwahrnehmung ein und beleuchtet die Verbindung zwischen universellen Prinzipien auditiver Strukturen und kulturell geprägten Formen. Hörexperimente aus der experimentellen Ästhetik ermöglichen es, exemplarisch die zugrundeliegenden Wahrnehmungsmechanismen mit eigenen Ohren nachzuvollziehen.
Beim bewussten Hören von Musik erleben viele Menschen Verknüpfungen von Klängen, die kleinere und größere Strukturen bilden, vom musikalischen Motiv bis hin zu Symphoniesätzen. Für die Komposition und Musiktheorie sind diese Strukturen von besonderer Relevanz. So wird zum Beispiel die Anzahl der Takte oft genau gezählt und mitunter in Verbindung mit Zahlen als Bedeutungsträger gebracht. Gilt dies aber auch normativ für das Musikhören? Hören wir nur dann adäquat, wenn wir das Seitenthema in der Durchführung als solches erkennen? Der Vortrag führt in die Psychologie der Musikwahrnehmung ein und beleuchtet die Verbindung zwischen universellen Prinzipien auditiver Strukturen und kulturell geprägten Formen. Hörexperimente aus der experimentellen Ästhetik ermöglichen es, exemplarisch die zugrundeliegenden Wahrnehmungsmechanismen mit eigenen Ohren nachzuvollziehen.
Thomas Hauser
(ehem. Chefredakteur und Herausgeber der Badischen Zeitung)
Expansion ohne Reform: Ralf Dahrendorfs „Bürgerrecht auf Bildung“ und die Mühlen der Tagespolitik
Donnerstag | 06.11.25 | 20 Uhr c.t. | HS 1015
 Wer nach dem Ursprung der Ideologisierung von Bildungspolitik in Deutschland sucht, wird in den Jahren von 1959 bis 1969 fündig. Damals wurden Weichen gestellt und Versprechen formuliert, die die Diskussion bis heute beeinflussen. 1965 wandelte der Soziologe Ralf Dahrendorf die Angst vor einer drohenden Bildungskatastrophe in die politische Forderung eines Bürgerrechts auf Bildung und gab so diesem Jahrzehnt der Bildungspolitik sein Schlagwort. Der Vortrag schildert die Aufbrauchstimmung der damaligen Zeit und reflektiert darüber, warum die Euphorie im politischen Alltag zerrieben wurde.
Wer nach dem Ursprung der Ideologisierung von Bildungspolitik in Deutschland sucht, wird in den Jahren von 1959 bis 1969 fündig. Damals wurden Weichen gestellt und Versprechen formuliert, die die Diskussion bis heute beeinflussen. 1965 wandelte der Soziologe Ralf Dahrendorf die Angst vor einer drohenden Bildungskatastrophe in die politische Forderung eines Bürgerrechts auf Bildung und gab so diesem Jahrzehnt der Bildungspolitik sein Schlagwort. Der Vortrag schildert die Aufbrauchstimmung der damaligen Zeit und reflektiert darüber, warum die Euphorie im politischen Alltag zerrieben wurde.
Prof. Dr. Timo Heimerdinger
(Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Freiburg)
Verzicht – zur Rehabilitation eines ungeliebten Konzepts
Montag | 10.11.25 | 20 Uhr c.t. | HS 1015
 ‚Verzicht‘ ist denkbar unpopulär. Quer durch die politische Landschaft wird betont, dass man Verzicht nicht wolle: weder als politische Botschaft noch als persönliche Erfahrung. Als Lösung aller Probleme, vor allem der ökonomischen, wird vielmehr unisono ‚Wachstum‘ beschworen. Doch die derzeitigen Krisen, allen voran die ökologische, fordern grundlegendes Nachdenken über Formen der freiwilligen Selbstrücknahme heraus. Warum fallen das Sprechen über und das Bekenntnis zum Verzicht so schwer? Was eigentlich ist das Skandalon am Verzicht, das ihn zu einem polemisch gefärbten Kampfbegriff werden lässt? Der Vortrag entwickelt das Konzept des Verzichts zunächst begrifflich und konfrontiert dann die verbreitete Abwehrhaltung mit überraschenden historischen und empirischen Befunden. Verzicht erscheint so als vielschichtig eingeübte Kulturpraxis mit Subversions- und Transformationspotenzial. Vielleicht kann Verzicht sogar Wege zu einem neuen, produktiven Selbst- und Weltverhältnis weisen.
‚Verzicht‘ ist denkbar unpopulär. Quer durch die politische Landschaft wird betont, dass man Verzicht nicht wolle: weder als politische Botschaft noch als persönliche Erfahrung. Als Lösung aller Probleme, vor allem der ökonomischen, wird vielmehr unisono ‚Wachstum‘ beschworen. Doch die derzeitigen Krisen, allen voran die ökologische, fordern grundlegendes Nachdenken über Formen der freiwilligen Selbstrücknahme heraus. Warum fallen das Sprechen über und das Bekenntnis zum Verzicht so schwer? Was eigentlich ist das Skandalon am Verzicht, das ihn zu einem polemisch gefärbten Kampfbegriff werden lässt? Der Vortrag entwickelt das Konzept des Verzichts zunächst begrifflich und konfrontiert dann die verbreitete Abwehrhaltung mit überraschenden historischen und empirischen Befunden. Verzicht erscheint so als vielschichtig eingeübte Kulturpraxis mit Subversions- und Transformationspotenzial. Vielleicht kann Verzicht sogar Wege zu einem neuen, produktiven Selbst- und Weltverhältnis weisen.
Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Detering
(Seminar für Deutsche Philologie, Georg-August-Universität Göttingen)
Die Erde und das Kapital: Karl Marx liest Goethe
Freitag | 28.11.25 | 18 Uhr c.t. | HS 1015
In Zusammenarbeit mit der Goethe-Gesellschaft Freiburg und dem Deutschen Seminar
 Karl Marx’ Denken entfaltet sich von der Studienzeit bis in die letzten Entwürfe hinein in einer intensiven Auseinandersetzung nicht nur mit ökonomischen und soziologischen, sondern auch mit literarischen Gesprächspartnern, von Shakespeare bis zur deutschen Romantik. Unter ihnen ist Goethe einer der wichtigsten. Als Anreger und Argumentationshelfer begleitet er Marx lebenslang. Umgekehrt fällt von Marx’ Lektüren aus neues Licht auch auf unsere Wahrnehmung Goethes. Das gilt vor allem für die Frage nach dem Verhältnis von Kapitalismus, Natur und Naturzerstörung. Diesen Beziehungen und ihrer möglichen Bedeutung für unsere Zeit geht der Vortrag nach.
Karl Marx’ Denken entfaltet sich von der Studienzeit bis in die letzten Entwürfe hinein in einer intensiven Auseinandersetzung nicht nur mit ökonomischen und soziologischen, sondern auch mit literarischen Gesprächspartnern, von Shakespeare bis zur deutschen Romantik. Unter ihnen ist Goethe einer der wichtigsten. Als Anreger und Argumentationshelfer begleitet er Marx lebenslang. Umgekehrt fällt von Marx’ Lektüren aus neues Licht auch auf unsere Wahrnehmung Goethes. Das gilt vor allem für die Frage nach dem Verhältnis von Kapitalismus, Natur und Naturzerstörung. Diesen Beziehungen und ihrer möglichen Bedeutung für unsere Zeit geht der Vortrag nach.
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Mair
(Englisches Seminar, Universität Freiburg)
Was macht die KI mit unseren Sprachen?
Dienstag | 02.12.25 | 20 Uhr c.t. | HS 1015
 Nach einer längeren Phase der Stagnation haben sich die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Sprachtechnologien in den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Für eine wachsende Anzahl von Sprachen funktionieren maschinelle Übersetzung und automatische Textgenerierung auf praxistauglichem Niveau, ebenso wie die Konversion von Laut in Schrift und umgekehrt. Die zunehmende Technologisierung von Sprachen wirft allerdings auch Probleme auf, die der Vortrag exemplarisch illustriert. Angesprochen werden v.a. die Themenkomplexe Inklusion vs. Exklusion – nach wie vor sind die Segnungen der neuen Technologien unter den Sprachen der Welt sehr ungleich verteilt – und Standardisierung/Sprachplanung. Denn selbst für Sprachen wie das Englische und Deutsche, die im technologischen Wettbewerb klar auf der Gewinnerseite stehen, ergeben sich potentiell schädliche Folgen. Die von den großen Sprachmodellen der KI bewirkte Homogenisierung deckt sich nur teilweise mit den traditionellen bildungssprachlichen Normen von gutem Deutsch oder Englisch. Es stellt sich die Frage, wieviel Sprachplanung wir in Zukunft an Algorithmen und Maschinen auslagern wollen oder müssen.
Nach einer längeren Phase der Stagnation haben sich die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Sprachtechnologien in den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt und beeindruckende Ergebnisse erzielt. Für eine wachsende Anzahl von Sprachen funktionieren maschinelle Übersetzung und automatische Textgenerierung auf praxistauglichem Niveau, ebenso wie die Konversion von Laut in Schrift und umgekehrt. Die zunehmende Technologisierung von Sprachen wirft allerdings auch Probleme auf, die der Vortrag exemplarisch illustriert. Angesprochen werden v.a. die Themenkomplexe Inklusion vs. Exklusion – nach wie vor sind die Segnungen der neuen Technologien unter den Sprachen der Welt sehr ungleich verteilt – und Standardisierung/Sprachplanung. Denn selbst für Sprachen wie das Englische und Deutsche, die im technologischen Wettbewerb klar auf der Gewinnerseite stehen, ergeben sich potentiell schädliche Folgen. Die von den großen Sprachmodellen der KI bewirkte Homogenisierung deckt sich nur teilweise mit den traditionellen bildungssprachlichen Normen von gutem Deutsch oder Englisch. Es stellt sich die Frage, wieviel Sprachplanung wir in Zukunft an Algorithmen und Maschinen auslagern wollen oder müssen.
ENTFÄLLT:
Prof. Dr. Juliane Blank
(Deutsches Seminar, Universität Freiburg)
Faust-Adaptionen im Comic. Parodie, Aktualisierung, Klassiker-Hommage
In Zusammenarbeit mit der Goethe-Gesellschaft Freiburg und dem Deutschen Seminar
 Literarische Texte werden seit Jahrzehnten immer wieder auch von Comicschaffenden aufgegriffen, bearbeitet und interpretiert. Der international am häufigsten im Comic adaptierte deutschsprachige Text ist Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil. Allein auf dem deutschen Comicmarkt erscheint seit den 1990er Jahren im Schnitt alle fünf Jahre ein neuer Faust- oder Goethe-Comic. – Die Veränderungen, die bei der Transformation von literarischen Texten in den Comic unweigerlich entstehen, sind produktiv als natürlicher Bestandteil eines Medienwechsels und als Spuren künstlerischer Aneignung zu betrachten und nicht etwa als Mängelerscheinungen gegenüber einem ‚Original‘. Von der Vorstellung einer Werktreue hat sich die Adaptionsforschung weitgehend verabschiedet. Was bedeutet es also, wenn ein hochkanonisierter Text wie Goethes Faust immer wieder neu grafisch interpretiert wird? Welche Rolle spielt der ‚Klassiker‘-Status des berühmten Ausgangstextes für den Umgang der Comicschaffenden mit dem geliebten oder gehassten, auf jeden Fall aber prägenden Ausgangstext? Mit genauem Blick auf die medienspezifischen Adaptionsstrategien des Comics als populärkulturellem Medium geht der Vortrag der Frage nach, was Comics mit dem ‚Klassiker‘ tun, wie sie mit Goethes Faust – oder auch gegen ihn – arbeiten und welche Formen der Rezeption die Adaptionen erschließen.
Literarische Texte werden seit Jahrzehnten immer wieder auch von Comicschaffenden aufgegriffen, bearbeitet und interpretiert. Der international am häufigsten im Comic adaptierte deutschsprachige Text ist Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil. Allein auf dem deutschen Comicmarkt erscheint seit den 1990er Jahren im Schnitt alle fünf Jahre ein neuer Faust- oder Goethe-Comic. – Die Veränderungen, die bei der Transformation von literarischen Texten in den Comic unweigerlich entstehen, sind produktiv als natürlicher Bestandteil eines Medienwechsels und als Spuren künstlerischer Aneignung zu betrachten und nicht etwa als Mängelerscheinungen gegenüber einem ‚Original‘. Von der Vorstellung einer Werktreue hat sich die Adaptionsforschung weitgehend verabschiedet. Was bedeutet es also, wenn ein hochkanonisierter Text wie Goethes Faust immer wieder neu grafisch interpretiert wird? Welche Rolle spielt der ‚Klassiker‘-Status des berühmten Ausgangstextes für den Umgang der Comicschaffenden mit dem geliebten oder gehassten, auf jeden Fall aber prägenden Ausgangstext? Mit genauem Blick auf die medienspezifischen Adaptionsstrategien des Comics als populärkulturellem Medium geht der Vortrag der Frage nach, was Comics mit dem ‚Klassiker‘ tun, wie sie mit Goethes Faust – oder auch gegen ihn – arbeiten und welche Formen der Rezeption die Adaptionen erschließen.
Wer Lust hat, sich aktiv auf den Vortrag vorzubereiten, könnte z.B. einen der folgenden Comics lesen:
- Flix: Faust. Der Tragödie erster Teil. Carlsen 2010.
- Jan Krauss und Alexander Pavlenko: Faust. Nach Goethes Faust I. Edition Faust 2025.
- Falk Nordmann. Faust. Edition B & K 1996.
- Christian Schieckel: Faust. Der Tragödie erster Teil. Prometh 1991.
- Roya Soraya: Faust. Eine Tragödie. Zwerchfell 2022.
Dr. Rüdiger Nolte
(Berlin, ehem. Rektor der Hochschule für Musik Freiburg)
„deyner sunde Diener“? Johann Sebastian Bachs Kunst und die Judenverachtung
Donnerstag | 05.02.26 | 18 Uhr c.t. | HS 1015
 Sind in Bachs Passionen die „Jüden“ Schuld an Jesu Kreuzigung? Oder haben sie dabei eine Funktion zu übernehmen? Bachs Dramaturgie legt das nah. Im Vortrag wird versucht, Fragen zu klären. Wie unterscheidet Bach die „Berichte“ aus den Evangelien vom „Bedenken“ des Verhältnisses von Sündlosigkeit und christlicher Schuld? Nicht selten wird dieses Bedenken als Beleg dafür genommen, dass es Bach gar nicht um Judenverachtung gegangen sei. Was ist aber mit indirekter Judenverachtung? Und warum die auffällig komponierten Judenchöre? – Kompositorische Vollkommenheit und Verstrickung. Wie gehen wir für uns mit solchen Spiegelungen um? Anders als im Fall des rassistischen Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert hatte sich Judenverachtung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wie eine europäische Konvention verselbständigt, wie eine alternativlose Verstrickung. Oder kennt jemand ein Zeugnis bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, das gegen Judenverachtung argumentiert hätte?
Sind in Bachs Passionen die „Jüden“ Schuld an Jesu Kreuzigung? Oder haben sie dabei eine Funktion zu übernehmen? Bachs Dramaturgie legt das nah. Im Vortrag wird versucht, Fragen zu klären. Wie unterscheidet Bach die „Berichte“ aus den Evangelien vom „Bedenken“ des Verhältnisses von Sündlosigkeit und christlicher Schuld? Nicht selten wird dieses Bedenken als Beleg dafür genommen, dass es Bach gar nicht um Judenverachtung gegangen sei. Was ist aber mit indirekter Judenverachtung? Und warum die auffällig komponierten Judenchöre? – Kompositorische Vollkommenheit und Verstrickung. Wie gehen wir für uns mit solchen Spiegelungen um? Anders als im Fall des rassistischen Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert hatte sich Judenverachtung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts wie eine europäische Konvention verselbständigt, wie eine alternativlose Verstrickung. Oder kennt jemand ein Zeugnis bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, das gegen Judenverachtung argumentiert hätte?