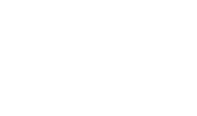Samstags-Uni: Freiburg en détail: Eine Kulturgeschichte in Objekten

© Foto Sandra Meyndt
In entfernter Anlehnung an das berühmte Radio- und Ausstellungs-Projekt A History of the World in 100 Objects des British Museum und seines damaligen Direktors Neil MacGregor aus dem Jahr 2010/11 widmet sich die Samstags-Uni von Studium generale und Volkshochschule Freiburg in ihrer 36. Staffel im Wintersemester 2025/26 einem Kursus in gelehrter, anschaulicher und anspruchsvoll-unterhaltsamer ‚Heimatkunde‘. Nicht im Maßstab der ‚Welt‘, sondern im Blick auf den Mikrokosmos des Freiburger Stadtraums werden ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Archäologie, Geschichtswissenschaft, Literatur-, Kultur- und Kunstgeschichte Freiburger Geschichte und Geschichten erzählen, ausgehend von einzelnen markanten, schönen oder faszinierenden, mitunter auch kuriosen oder beklemmenden, immer aber sprechenden Objekten aus den Tiefen der Jahrhunderte vom Mittelalter bis zur Gegenwart: einem Stadttor aus Zähringer-Zeiten, archäologischen Grabungsfunden aus der Neuburg, dem Turmhelm, einem Glasfenster oder einem närrischen Wasserspeier des Münsters, einem mittelalterlichen Patrizierteppich mit mythologischen Motiven oder einem Universitätszepter, einem klösterlichen Gebetbuch oder einem Totentanz auf dem Alten Friedhof, royalen Lämpchen oder Denkmälern von Siegen und Niederlagen, dem Mahnmal eines „Vergessenen Mantels“ auf der Wiwilí-Brücke oder einer modernen Skulptur auf dem Campus der Technischen Fakultät. „Freiburg en détail: Eine Kulturgeschichte in Objekten“ – lassen Sie sich überraschen!
Die Vorträge finden samstags zwischen 11:15 Uhr und 12:45 Uhr im HS 1010 im Kollegiengebäude I der Universität statt und können kostenlos und ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Alle Vorträge der Reihe werden außerdem aufgezeichnet und zeitversetzt über Homepage und Medienportal des Studium generale zugänglich gemacht.
Samstag / 11 Uhr c.t. / HS 1010 (Kollegiengebäude I)
Prof. Dr. Thomas Zotz
(Historisches Seminar, Universität Freiburg)
Das Martinstor. Profanes Bauwerk aus der Zähringerzeit – ein Spiegel der Freiburger Geschichte
Samstag, 18.10.25
 Das Martinstor an der Südseite der Freiburger Altstadt gehört neben den spätromanischen Teilen des Münsters zu den einzigen baulichen Überresten Freiburgs aus der Zeit Herzog Bertolds V. von Zähringen. Der Vortrag ordnet zunächst das Martinstor in das Ensemble der unter den Zähringern begonnenen Ummauerung und der späteren Stadttore der Altstadt und Vorstädte ein und fragt nach der Bedeutung dieser frühen Stadtbefestigung für das Selbstverständnis und den Alltag der Stadt unter den Zähringern. In einem zweiten Teil geht es um die spätere Geschichte des Martinstores, um seine bauliche wie bildliche Gestaltung und Umgestaltung sowie um seine Funktion als Träger historischer Erinnerung an Ereignisse der frühneuzeitlichen Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner an einem markanten Punkt des öffentlichen Raums.
Das Martinstor an der Südseite der Freiburger Altstadt gehört neben den spätromanischen Teilen des Münsters zu den einzigen baulichen Überresten Freiburgs aus der Zeit Herzog Bertolds V. von Zähringen. Der Vortrag ordnet zunächst das Martinstor in das Ensemble der unter den Zähringern begonnenen Ummauerung und der späteren Stadttore der Altstadt und Vorstädte ein und fragt nach der Bedeutung dieser frühen Stadtbefestigung für das Selbstverständnis und den Alltag der Stadt unter den Zähringern. In einem zweiten Teil geht es um die spätere Geschichte des Martinstores, um seine bauliche wie bildliche Gestaltung und Umgestaltung sowie um seine Funktion als Träger historischer Erinnerung an Ereignisse der frühneuzeitlichen Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner an einem markanten Punkt des öffentlichen Raums.
Dr. Bertram Jenisch
(Stv. Fachbereichsleiter Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit,
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart)
Das Köpfchen aus der Neuburg: Freiburger Leben in der gewerblich strukturierten Vorstadt zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert
Samstag, 25.10.25

Bei den Rettungsgrabungen an der Albertstraße/ Ecke Habsburgerstraße in diesem Jahr wurde als singuläres Einzelstück das Fragment einer Tonfigur gefunden. Der Kopf eines Mannes ist mit einer Gugelhaube bedeckt. Offenbar ist hier ein einfacher Handwerker dargestellt, wie sie in der ehemaligen Neuburg wohnten. Das 4000 m² große Grabungsareal liegt in der ersten mittelalterlichen Stadterweiterung, die ab 1240 angelegt wurde und im Rahmen des Festungsbaus ab 1677 niedergelegt worden ist. Trotz der Überbauung durch das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Universitätsklinikum haben sich die Laufhorizonte der Mitte des 13. Jahrhunderts weitgehend erhalten. Zu beiden Seiten der erfassten Ziegelgasse reihen sich die unterkellerten Steinbauten, im Hofbereich lagen die Öfen der dort wohnenden Handwerker. Die Ausgrabung bietet einen einzigartigen Einblick in die Grundriss-Struktur des verschwundenen Stadtteils Neuburg.
Prof. Dr. Hans W. Hubert
(Kunstgeschichtliches Institut, Universität Freiburg)
Der Turmhelm des Freiburger Münsters
Samstag, 08.11.25
 Der Turm des Münsters mit seinem durchbrochenen Helm galt den Freiburgern schon im 15. Jahrhundert als modernes Weltwunder. Mit einer Gesamthöhe von ca. 116 m überragt er weithin sichtbar die Stadt und ist zu deren Symbol geworden. Blitzeinschläge und Stürme haben ihm im Laufe der Jahrhunderte jedoch schwer zugesetzt, so dass zwischen 2006 und 2018 umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig wurden. Diese erlaubten auch, das Bauwerk in besonderer Weise zu erforschen. Ausgehend von einer Einzelheit, nämlich einer einzelnen Maßwerköffnung, wollen wir versuchen, den ganzen Turmhelm in seiner technischen Machart und Besonderheit zu verstehen und seine Bedeutung im europäischen Kontext der Zeit aufzurollen: gewissermaßen vom Freiburger détail in die ganze Welt.
Der Turm des Münsters mit seinem durchbrochenen Helm galt den Freiburgern schon im 15. Jahrhundert als modernes Weltwunder. Mit einer Gesamthöhe von ca. 116 m überragt er weithin sichtbar die Stadt und ist zu deren Symbol geworden. Blitzeinschläge und Stürme haben ihm im Laufe der Jahrhunderte jedoch schwer zugesetzt, so dass zwischen 2006 und 2018 umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig wurden. Diese erlaubten auch, das Bauwerk in besonderer Weise zu erforschen. Ausgehend von einer Einzelheit, nämlich einer einzelnen Maßwerköffnung, wollen wir versuchen, den ganzen Turmhelm in seiner technischen Machart und Besonderheit zu verstehen und seine Bedeutung im europäischen Kontext der Zeit aufzurollen: gewissermaßen vom Freiburger détail in die ganze Welt.
JProf. Dr. Julia von Ditfurth
(Kunstgeschichtliches Institut, Universität Freiburg)
Das Bäckerfenster im Freiburger Münster: Mittelalterliche Glasmalerei als Fenster zur Vergangenheit
Samstag, 15.11.25

Das um 1330/1340 entstandene Bäckerfenster im Freiburger Münster zählt zu den herausragenden Beispielen mittelalterlicher Glasmalerei. Ein Close Reading öffnet die Fenster zur Vergangenheit: Wie wurde Glas, der erste von Menschen geschaffene „Kunststoff“, zu einem Medium leuchtender Bildwelten? Der Vortrag behandelt die kunsttechnischen Grundlagen dieser baugebundenen Monumentalmalerei, die bemerkenswerte Ikonografie der Heiligen Katharina – eine außergewöhnliche Wahl der Bäckerzunft – sowie das Verhältnis von Ornament und Bild in Bezug auf Rahmung und Bildnarration. Zudem eröffnen Bezüge zu anderen ausgewählten Fenstern des Freiburger Langhauses oder zu den hochkarätigen Glasmalereien in Königsfelden und York faszinierende Einblicke in die Verflechtungen der mittelalterlichen Glasmalerei.
Prof. Dr. Henrike Manuwald
(Seminar für Deutsche Philologie, Universität Göttingen)
Der Maltererteppich (um 1320/30): Zur imaginären Macht der Frauen zwischen Stadt, Burg und Kloster
Samstag, 22.11.25

Um 1320/30 wurde der ,Maltererteppich‘ als Behang für die Rückenlehne einer Sitzbank angefertigt. Seinen Namen bekam er wegen des darauf zu sehenden Wappens der Freiburger Patrizierfamilie Malterer. Daneben zeigt der Behang mehrere Bildszenen: überwiegend die Überlistung verliebter Männer durch Frauen. Darstellungen des Artusritters Iwein und einer Dame mit Einhorn im Schoß scheinen allerdings nicht bruchlos zu dieser Thematik zu passen. Wie lässt sich das Bildprogramm deuten? Was besagt das Objekt für den Repräsentationswillen der Familie Malterer, die Anschluss an ritterliche Kultur suchte? Und wie mag der Behang ins Frauenkloster Adelhausen geraten sein, wo er im Jahr 1900 in einer Truhe aufgefunden wurde? Im Vortrag wird es um die literarischen, aber auch die regionalgeschichtlichen Bezugsräume des Objekts gehen.
Prof. Dr. Dieter Speck
(Direktor des Universitätsarchivs und Uniseums i.R. / stv. Vorstand des Alemannischen Instituts)
Zepter und Amtskette – Zu Interpretation und Nutzung der Freiburger Universitätsinsignien
Samstag, 29.11.25
 Die Universität Freiburg ist als moderne und forschungsstarke Universität bekannt. Nur wenig erinnert an ihre Jahrhunderte alte Geschichte und Tradition, auf der Homepage der Universität ist fast nichts davon zu finden. Zepter und Siegel der Universität sind Symbole und Zeichen einer spätmittelalterlichen Universität und auch Alleinstellungsmerkmale, die Freiburg von zahllosen anderen Universitäten unterscheidet. Freiburg gehört zu diesem kleinen und erlauchten Kreis von Universitäten mit jahrhundertelanger Tradition, die Zepter zeigen nach außen ihre rechtliche Sonderstellung als eigenständige Korporation. Als Zeichen der Würde des Rektors wurden die Zepter bei feierlichen Anlässen dem Rektor vorangetragen und später von der Rektorenkette abgelöst. Einblicke in die Geschichte, ihre Nutzung und den Symbolgehalt der Zepter und der Rektorenkette zu geben, ist Gegenstand des Vortrages.
Die Universität Freiburg ist als moderne und forschungsstarke Universität bekannt. Nur wenig erinnert an ihre Jahrhunderte alte Geschichte und Tradition, auf der Homepage der Universität ist fast nichts davon zu finden. Zepter und Siegel der Universität sind Symbole und Zeichen einer spätmittelalterlichen Universität und auch Alleinstellungsmerkmale, die Freiburg von zahllosen anderen Universitäten unterscheidet. Freiburg gehört zu diesem kleinen und erlauchten Kreis von Universitäten mit jahrhundertelanger Tradition, die Zepter zeigen nach außen ihre rechtliche Sonderstellung als eigenständige Korporation. Als Zeichen der Würde des Rektors wurden die Zepter bei feierlichen Anlässen dem Rektor vorangetragen und später von der Rektorenkette abgelöst. Einblicke in die Geschichte, ihre Nutzung und den Symbolgehalt der Zepter und der Rektorenkette zu geben, ist Gegenstand des Vortrages.
Prof. Dr. Martina Backes
(Deutsches Seminar, Universität Freiburg)
Ein Buch für die Frauen des Klaraklosters. Die Freiburger Buchmalerin Sibilla von Bondorf und ein vergessenes Kleinod aus dem Besitz der Adelhausenstiftung
Samstag, 06.12.25
 Nur 11 x 8 cm misst die kleine Handschrift aus dem Besitz der Adelhausen-stiftung, die als Dauerleihgabe im Freiburger Augustinermuseum liegt. Sie entstand um 1500 vermutlich für die Frauen des Freiburger Klaraklosters und enthält neben zahlreichen anmutigen Randillustrationen eine ikonographisch höchst ungewöhnliche Miniatur: Das Bild, das Maria als Priesterin zeigt, stammt von der Freiburger Buchmalerin Sibilla von Bondorf. Der Vortrag bietet Einblicke in diese besondere Handschrift, das Leben einer spätmittelalterlichen Buchmalerin, die materielle Kultur der Freiburger Frauenklöster und aktuelle Probleme der modernen Konservierung alter Handschriften.
Nur 11 x 8 cm misst die kleine Handschrift aus dem Besitz der Adelhausen-stiftung, die als Dauerleihgabe im Freiburger Augustinermuseum liegt. Sie entstand um 1500 vermutlich für die Frauen des Freiburger Klaraklosters und enthält neben zahlreichen anmutigen Randillustrationen eine ikonographisch höchst ungewöhnliche Miniatur: Das Bild, das Maria als Priesterin zeigt, stammt von der Freiburger Buchmalerin Sibilla von Bondorf. Der Vortrag bietet Einblicke in diese besondere Handschrift, das Leben einer spätmittelalterlichen Buchmalerin, die materielle Kultur der Freiburger Frauenklöster und aktuelle Probleme der modernen Konservierung alter Handschriften.
Dr. Valerie Möhle
(Kunsthistorikerin, Universität Freiburg und Gesellschaft der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs in Freiburg e.V.)
Der Totentanz auf dem Alten Friedhof. Zu den (pseudo)barocken Wandmalereien der Michaelskapelle
Samstag, 13.12.25
 Der Alte Friedhof in Freiburg zählt mit seinem umfangreichen Bestand an Grabmalen des 18. und 19. Jahrhunderts zu den bedeutenden historischen Friedhöfen Deutschlands. Bereichert wird er durch eine kleine Friedhofskapelle, die barocke Michaelskapelle. Gegenstand des Vortrags sind die Wandmalereien in der Vorhalle, zu denen – thematisch passend – ein gemalter Totentanz gehört. Ungeachtet der barocken Anmutung handelt es sich jedoch um ein Werk der 1960er Jahre – eine freie Neuschöpfung nach kriegsbedingter Zerstörung, der bereits im 19. Jahrhundert zwei bildlich dokumentierte Erneuerungen vorausgingen. Der Vortrag beleuchtet diese verwirrende Objektgeschichte und fragt nach den Unterschieden zwischen den Versionen ebenso wie nach dem Verhältnis zur Darstellungstradition.
Der Alte Friedhof in Freiburg zählt mit seinem umfangreichen Bestand an Grabmalen des 18. und 19. Jahrhunderts zu den bedeutenden historischen Friedhöfen Deutschlands. Bereichert wird er durch eine kleine Friedhofskapelle, die barocke Michaelskapelle. Gegenstand des Vortrags sind die Wandmalereien in der Vorhalle, zu denen – thematisch passend – ein gemalter Totentanz gehört. Ungeachtet der barocken Anmutung handelt es sich jedoch um ein Werk der 1960er Jahre – eine freie Neuschöpfung nach kriegsbedingter Zerstörung, der bereits im 19. Jahrhundert zwei bildlich dokumentierte Erneuerungen vorausgingen. Der Vortrag beleuchtet diese verwirrende Objektgeschichte und fragt nach den Unterschieden zwischen den Versionen ebenso wie nach dem Verhältnis zur Darstellungstradition.
Peter Kalchthaler, M.A.
(Kunsthistoriker / Direktor des Augustinermuseums i.R.)
Die Lämpchen der Dauphine: Der Aufenthalt Marie Antoinettes in Freiburg auf ihrer Brautfahrt 1770
Samstag, 20.12.25
 Zu den bedeutendsten Ereignissen im barocken Freiburg gehörte sicher der Besuch der französischen Kronprinzessin Marie Antoinette auf ihrem Brautzug von Wien nach Paris. Für die einstige Festungsstadt Freiburg hatte die Verbindung zwischen Österreich und Frankreich eine besondere Bedeutung, denn mit der Heirat der Erzherzogin mit dem Thronfolger wurde der Frieden besiegelt, den die lange verfeindeten Nationen zwischen 1756 und 1758 in mehreren Verträgen beschlossen hatten. Ausführliche und mit Kupferstichen illustrierte Berichte dokumentierten die Feierlichkeiten. Die einzige materielle Hinterlassenschaft sind tönerne Lämpchen, die man beim Bau des Hauses der Jugend in den 1960er Jahren auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Bauhofs gefunden hat. Sie dienten 1770 zur festlichen „Illumination“ von Gebäuden, des Münsterturms und der eigens errichteten Festarchitekturen.
Zu den bedeutendsten Ereignissen im barocken Freiburg gehörte sicher der Besuch der französischen Kronprinzessin Marie Antoinette auf ihrem Brautzug von Wien nach Paris. Für die einstige Festungsstadt Freiburg hatte die Verbindung zwischen Österreich und Frankreich eine besondere Bedeutung, denn mit der Heirat der Erzherzogin mit dem Thronfolger wurde der Frieden besiegelt, den die lange verfeindeten Nationen zwischen 1756 und 1758 in mehreren Verträgen beschlossen hatten. Ausführliche und mit Kupferstichen illustrierte Berichte dokumentierten die Feierlichkeiten. Die einzige materielle Hinterlassenschaft sind tönerne Lämpchen, die man beim Bau des Hauses der Jugend in den 1960er Jahren auf dem Gelände des ehemaligen städtischen Bauhofs gefunden hat. Sie dienten 1770 zur festlichen „Illumination“ von Gebäuden, des Münsterturms und der eigens errichteten Festarchitekturen.
Prof. Dr. Jörn Leonhard
(Historisches Seminar, Universität Freiburg)
Das Freiburger Rotteck-Denkmal: Von den Ambivalenzen des deutschen Liberalismus zu den Widersprüchen „korrekter“ Erinnerung
Samstag, 10.01.26
 Die Geschichte des Denkmals für den Freiburger Historiker und badischen Liberalen Karl von Rotteck, einen der bekanntesten politischen Professoren Deutschlands vor der Revolution 1848/49, fasst wie unter einem Brennglas gleich mehrere Zeitschichten zusammen. Denn der mehrfache Wechsel der Aufstellungsorte des Denkmals in Freiburg verweist auf die Geschichte des Liberalismus nach 1815, auf die politische Kultur des deutschen Vormärz und auf den Umgang mit politischer Opposition in der lokalen Erinnerung nach 1848/49, aber ebenso auf unseren heutigen Umgang mit den Erbschaften des frühen 19. Jahrhunderts. Was der Zusammenhang aus umstrittener Erinnerung und kontrovers diskutierter „Denkmalwürdigkeit“ über unseren eigenen Umgang mit der Geschichte und ihrem Erbe sagt, enthüllt die Geschichte des Rotteck-Denkmals in geradezu paradigmatischer Weise.
Die Geschichte des Denkmals für den Freiburger Historiker und badischen Liberalen Karl von Rotteck, einen der bekanntesten politischen Professoren Deutschlands vor der Revolution 1848/49, fasst wie unter einem Brennglas gleich mehrere Zeitschichten zusammen. Denn der mehrfache Wechsel der Aufstellungsorte des Denkmals in Freiburg verweist auf die Geschichte des Liberalismus nach 1815, auf die politische Kultur des deutschen Vormärz und auf den Umgang mit politischer Opposition in der lokalen Erinnerung nach 1848/49, aber ebenso auf unseren heutigen Umgang mit den Erbschaften des frühen 19. Jahrhunderts. Was der Zusammenhang aus umstrittener Erinnerung und kontrovers diskutierter „Denkmalwürdigkeit“ über unseren eigenen Umgang mit der Geschichte und ihrem Erbe sagt, enthüllt die Geschichte des Rotteck-Denkmals in geradezu paradigmatischer Weise.
Heinz Siebold
(Historischer Publizist, Freiburg/Lahr)
Das Dortu-Mausoleum auf dem alten Wiehre-Friedhof. Ein Erinnerungsort für die deutsche Demokratiebewegung von 1848/49
Samstag, 17.01.26
 Das Grabmal des aus Potsdam stammenden Revolutionärs Maximilian Dortu (1826-1848) auf dem ehemaligen Friedhof des Freiburger Stadtteils Wiehre (Ecke Dreikönigs-/Erwinstraße) – heute ein Spielplatz – ist ein historischer Erinnerungsort mit Seltenheitswert: Dort vollstreckte die preußische Militärjustiz drei Todesurteile gegen Teilnehmer des badischen Aufstandes im Frühsommer 1849. Maximilian Dortu wurde wegen „Kriegsverrats“ zum Tode verurteilt und am 31. Juli 1849 hingerichtet. Dass sein Grabmal noch heute existiert, ist das Verdienst seiner Mutter. Sie vermachte in ihrem Testament der Stadt Freiburg 1000 Gulden mit der Verpflichtung, das Grab „auf ewige Zeiten“ zu pflegen, was der Gemeinderat von Freiburg am 21. Januar 1862 zusicherte. Das Dortu-Mausoleum wurde so zum Gedenk- und Erinnerungsort Freiburger Demokraten.
Das Grabmal des aus Potsdam stammenden Revolutionärs Maximilian Dortu (1826-1848) auf dem ehemaligen Friedhof des Freiburger Stadtteils Wiehre (Ecke Dreikönigs-/Erwinstraße) – heute ein Spielplatz – ist ein historischer Erinnerungsort mit Seltenheitswert: Dort vollstreckte die preußische Militärjustiz drei Todesurteile gegen Teilnehmer des badischen Aufstandes im Frühsommer 1849. Maximilian Dortu wurde wegen „Kriegsverrats“ zum Tode verurteilt und am 31. Juli 1849 hingerichtet. Dass sein Grabmal noch heute existiert, ist das Verdienst seiner Mutter. Sie vermachte in ihrem Testament der Stadt Freiburg 1000 Gulden mit der Verpflichtung, das Grab „auf ewige Zeiten“ zu pflegen, was der Gemeinderat von Freiburg am 21. Januar 1862 zusicherte. Das Dortu-Mausoleum wurde so zum Gedenk- und Erinnerungsort Freiburger Demokraten.
Dr. Heinrich Schwendemann
(Historisches Seminar, Universität Freiburg)
Das Siegesdenkmal – von „Badens Gloria“ zum „Mahnmal gegen Krieg und Nationalismus“
Samstag, 24.01.26
 Das Denkmal zur Erinnerung an die Kämpfe badischer Truppen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 war bei seiner Einweihung am 3. Oktober 1876 eine Besonderheit: Es stellte nicht den siegreichen Feldherrn, sondern vier einfache, namenlose Soldaten auf das Podest. Auch vermied der Bildhauer Friedrich Moest eine visuelle „Demüthigung“ Frankreichs, versah aber sein Werk subtil mit preußenkritischen Elementen. Während des Zweiten Weltkrieges war das Monument zunächst als Metallspende für den „Führer“ vorgesehen, überstand dann aber selbst den britischen Bombenangriff vom 27. November 1944 und wurde danach von der französischen Besatzungsmacht vor Ort belassen. Bedroht war seine Existenz mehrfach durch Initiativen, es als ein Symbol des preußisch-deutschen Militarismus zu beseitigen. So gab es nach einem verkehrstechnisch bedingten Abbau 2016 innerhalb des Stadtrates „scharfe Debatten“, der dann aber mehrheitlich beschloss, das Siegesdenkmal – umgedeutet in ein „Mahnmal gegen Krieg und Nationalismus“ – wiederaufbauen zu lassen. Seit November 2017 steht es wieder am historischen Ort vor der ehemaligen Karlskaserne.
Das Denkmal zur Erinnerung an die Kämpfe badischer Truppen im deutsch-französischen Krieg 1870/71 war bei seiner Einweihung am 3. Oktober 1876 eine Besonderheit: Es stellte nicht den siegreichen Feldherrn, sondern vier einfache, namenlose Soldaten auf das Podest. Auch vermied der Bildhauer Friedrich Moest eine visuelle „Demüthigung“ Frankreichs, versah aber sein Werk subtil mit preußenkritischen Elementen. Während des Zweiten Weltkrieges war das Monument zunächst als Metallspende für den „Führer“ vorgesehen, überstand dann aber selbst den britischen Bombenangriff vom 27. November 1944 und wurde danach von der französischen Besatzungsmacht vor Ort belassen. Bedroht war seine Existenz mehrfach durch Initiativen, es als ein Symbol des preußisch-deutschen Militarismus zu beseitigen. So gab es nach einem verkehrstechnisch bedingten Abbau 2016 innerhalb des Stadtrates „scharfe Debatten“, der dann aber mehrheitlich beschloss, das Siegesdenkmal – umgedeutet in ein „Mahnmal gegen Krieg und Nationalismus“ – wiederaufbauen zu lassen. Seit November 2017 steht es wieder am historischen Ort vor der ehemaligen Karlskaserne.
ENTFÄLLT: Prof. Dr. Werner Mezger
(Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Freiburg)
Der Narr am Freiburger Münster und sein Kontext: Von der Resilienz der Dummheit
DER VORTRAG MUSS LEIDER WEGEN KRANKHEIT ENTFALLEN.
Samstag, 31.01.26
 An der Südseite des Freiburger Münsters befindet sich als Wasserspeier ein Narr aus dem 16. Jahrhundert. Mit Fastnacht hat er allerdings wenig zu tun. Vielmehr ist er steinerner Zeuge jener Konjunktur der Narrenidee, die 1494 mit Sebastian Brants Narrenschiff begann, 1511 durch das Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam eine geniale ironische Brechung erfuhr und in den Schriften von Thomas Murner zu sprachlichen Metaphern fand, die noch immer lebendig sind. Der Narr wurde damals als Medium der Zeitkritik geradezu ein Signum der Epoche. Zur kontextuellen Vertiefung der Freiburger Steinplastik zieht der Vortrag noch einen filigran bemalten Prunkteller aus Augsburg von 1528 heran, dessen Bilderzyklus die Unsterblichkeit menschlicher Dummheit visualisiert. Am Ende wird sich zeigen, dass die vor 500 Jahren diskutierte Thematik der Narrheit, wie sie im Freiburger Münsternarren Gestalt gewann, heute aktueller ist denn je.
An der Südseite des Freiburger Münsters befindet sich als Wasserspeier ein Narr aus dem 16. Jahrhundert. Mit Fastnacht hat er allerdings wenig zu tun. Vielmehr ist er steinerner Zeuge jener Konjunktur der Narrenidee, die 1494 mit Sebastian Brants Narrenschiff begann, 1511 durch das Lob der Torheit des Erasmus von Rotterdam eine geniale ironische Brechung erfuhr und in den Schriften von Thomas Murner zu sprachlichen Metaphern fand, die noch immer lebendig sind. Der Narr wurde damals als Medium der Zeitkritik geradezu ein Signum der Epoche. Zur kontextuellen Vertiefung der Freiburger Steinplastik zieht der Vortrag noch einen filigran bemalten Prunkteller aus Augsburg von 1528 heran, dessen Bilderzyklus die Unsterblichkeit menschlicher Dummheit visualisiert. Am Ende wird sich zeigen, dass die vor 500 Jahren diskutierte Thematik der Narrheit, wie sie im Freiburger Münsternarren Gestalt gewann, heute aktueller ist denn je.
Julia Wolrab, M.A.
(Wiss. Leiterin, Dokumentationszentrum Nationalsozialismus der Museen Freiburg)
Der „vergessene Mantel“ auf der Wiwilí-Brücke in der Landschaft der Freiburger Erinnerungskultur. Vergessene Orte oder Orte gegen das Vergessen?
Samstag, 07.02.26
 Auf der Wiwilí-Brücke beim Hauptbahnhof, von wo aus im Oktober 1940 mindestens 379 Freiburger*innen ins südfranzösische Lager Gurs deportiert wurden, befindet sich seit 2003 ein bronzenes Denkmal der Bildhauerin Birgit Stauch. Wie ein zurückgelassenes Gepäckstück erinnert der „vergessene Mantel” neben einer Gedenktafel an die Menschen, die in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1940 nur wenige Meter entfernt die Züge in Richtung Gurs besteigen mussten. Der Vortrag beleuchtet die Geschichte dieses für viele immer noch unsichtbaren Objekts und weitet die Perspektive auf die breite und sich stets weiter ausdifferenzierende Erinnerungskultur und -praxis in Freiburg. An wen wird erinnert? Wie wird erinnert? Was sind aktuelle Herausforderungen der Erinnerungsarbeit? Und letztlich: Wie beeinflusst die Erinnerungsarbeit unser Zusammenleben? Diese Fragen können und sollen nicht abschließend beantwortet, Gedanken hierzu vielmehr formuliert und zur Diskussion gestellt werden.
Auf der Wiwilí-Brücke beim Hauptbahnhof, von wo aus im Oktober 1940 mindestens 379 Freiburger*innen ins südfranzösische Lager Gurs deportiert wurden, befindet sich seit 2003 ein bronzenes Denkmal der Bildhauerin Birgit Stauch. Wie ein zurückgelassenes Gepäckstück erinnert der „vergessene Mantel” neben einer Gedenktafel an die Menschen, die in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1940 nur wenige Meter entfernt die Züge in Richtung Gurs besteigen mussten. Der Vortrag beleuchtet die Geschichte dieses für viele immer noch unsichtbaren Objekts und weitet die Perspektive auf die breite und sich stets weiter ausdifferenzierende Erinnerungskultur und -praxis in Freiburg. An wen wird erinnert? Wie wird erinnert? Was sind aktuelle Herausforderungen der Erinnerungsarbeit? Und letztlich: Wie beeinflusst die Erinnerungsarbeit unser Zusammenleben? Diese Fragen können und sollen nicht abschließend beantwortet, Gedanken hierzu vielmehr formuliert und zur Diskussion gestellt werden.
Prof. Dr. Angeli Janhsen
(Kunstgeschichtliches Institut, Universität Freiburg)
„Jump and Twist“: Das Kunst-Flugzeug an der Technischen Fakultät
Samstag, 14.02.26
 Der amerikanische Konzeptkünstler Dennis Oppenheim (1938 – 2011) hat 1999 eine Arbeit in der Nähe des Flugplatzes realisiert: „Jump and Twist“, also „Springen und Wenden“. Ein einziges Objekt ist hier streng genommen nicht zu sehen – schon der Boden zwischen den Gebäuden ist auffällig gestaltet, und zwei der drei größeren flugzeugähnlichen Teile sieht man schon von der Straße oder der Straßenbahn aus. Ein dritter Teil befindet sich im Gebäude und ist von außen durch die Glaswand nur zu erahnen. Dieses Gebäude – für Kunst am Bau ist das wichtig – ist der Sitz der Technischen Fakultät. Hier studieren zukünftige Erfinder und Erfinderinnen unter dem Motto „Technik studieren. Zukunft gestalten. Welt verbessern.“ Was tun sie da?! Was ist unser Anspruch an Technik? Was ihrer? Was lässt sich überhaupt denken und entwickeln? Was kann Kunst dort und überhaupt ausrichten?
Der amerikanische Konzeptkünstler Dennis Oppenheim (1938 – 2011) hat 1999 eine Arbeit in der Nähe des Flugplatzes realisiert: „Jump and Twist“, also „Springen und Wenden“. Ein einziges Objekt ist hier streng genommen nicht zu sehen – schon der Boden zwischen den Gebäuden ist auffällig gestaltet, und zwei der drei größeren flugzeugähnlichen Teile sieht man schon von der Straße oder der Straßenbahn aus. Ein dritter Teil befindet sich im Gebäude und ist von außen durch die Glaswand nur zu erahnen. Dieses Gebäude – für Kunst am Bau ist das wichtig – ist der Sitz der Technischen Fakultät. Hier studieren zukünftige Erfinder und Erfinderinnen unter dem Motto „Technik studieren. Zukunft gestalten. Welt verbessern.“ Was tun sie da?! Was ist unser Anspruch an Technik? Was ihrer? Was lässt sich überhaupt denken und entwickeln? Was kann Kunst dort und überhaupt ausrichten?
Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Freiburg und der Badischen Zeitung