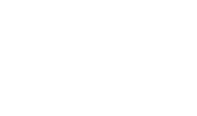Vortragsreihen
10 Jahre Pariser Klimaabkommen – Eine kritische Bestandsaufnahme
In Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg, der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg, der Landeszentale für Politische Bildung Freiburg, beraten durch die Stiftung Klimaneutralität und das Center for Sustainable Society Research (CSS) der Universität Hamburg
Über die Reihe: Vor 10 Jahren, am 12.12.2015, wurde auf der Weltklimakonferenz das „Übereinkommen von Paris“ beschlossen. Darin verpflichten sich 195 Staaten, den Klimawandel einzudämmen und die Weltwirtschaft klimafreundlich umzugestalten. Das konkret gefasste Ziel: Den weltweiten Temperaturan-stieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius, auf jeden Fall aber auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Anders als das zuvor verhandelte Kyoto Protokoll haben sich in Paris alle Staaten der Erde völkerrechtlich verpflichtet, einen nationalen Klimabeitrag zu erarbeiten und über die Fortschritte ihrer Bemühungen regelmäßig zu berich-ten. Das wurde zu Recht als Durchbruch gefeiert. Es war der vielleicht wichtigste Schritt auf einem Weg, den die internationale Staatengemeinschaft 1992 bei der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro mit dem ersten völkerrechtlich verbindlichen Abkommen zum Klimaschutz begonnen hatte.
10 Jahre später müssen wir jedoch feststellen, dass keiner der Unterzeichnerstaaten die eingegangenen Selbstverpflichtungen eingelöst hat. Das 1,5 Grad-Ziel gilt mittlerweile als nicht mehr erreichbar. Ist das ein Anlass, die Relevanz von internationalen Klimakonferenzen grundsätzlich in Frage zu stellen? Oder gibt es gute Gründe, den Prozess dieser Bemühungen trotz aller Zweifel fortzusetzen? Gibt es positive Wirkungen, die ohne sie nicht eingetreten wären? Welche Rolle spielen sie für die sogenannte Klimagerechtigkeit? Und wie könnte den Abkommen und ihren Beschlüssen eine größere Geltung im politischen Handeln verschafft werden?
In vier Veranstaltungen werden diese Fragen im Fokus stehen. Sie sind thema-tisch folgendermaßen gegliedert:
- Was genau wurde in Paris verabredet? Welche Verbindlichkeit haben diese Verabredungen angenommen? Welche Folgewirkungen lassen sich beschreiben.
- Welche Entwicklungen haben die Klimakonferenzen seither genonmen? Warum sollten wir diesen Prozess fortsetzen? Welche Aspekte sind kritisch zu sehen?
- Warum verfehlen wir die beschlossenen Ziele? Welche Lobbys und Interessen arbeiten dagegen? Welche Regime/Ordnungen sind hinderlich? Welche Reformen wären nötig?
- Welchen Beitrag sollten/könnten die Konferenzen für die weltweite Klimagerechtigkeit erbringen? Welche Ausgleichsleistungen zwischen reichen und armen, verursachenden und leidenden Ländern müssten erarbeitet werden?
|
Donnerstag |
10 Jahre Pariser Klimaabkommen – Eine kritische Be-standsaufnahme – Teil 1 Themen: Was wurde im Dezember 2015 in Paris vereinbart? Welche Folgewirkungen hat das Abkommen in den wech-selnden geopolitischen Lagen bis heute? Was kann dieses Abkommen erreichen, was kann es nicht erreichen? Welche zukünftigen Aussichten verbinden sich mit diesem Abkommen? Vortrag: Jürgen Trittin (Bundesumweltminister a.D.) Im Anschluss: Podiumsdiskussion Georg Ehring (Deutschlandfunk) Dr. Karsten Sach (Beirat der Stiftung Klimaneutrali-tät) Jürgen Trittin (Bundesumweltminister a.D.) |
| Donnerstag 22.01.26 18 Uhr c.t. Aula KG I |
10 Jahre Pariser Klimaabkommen – Eine kritische Be-standsaufnahme – Teil 2 Themen: Von Kyoto bis Paris, Rio de Janeiro und weiter – Eine kritische Revision der Entwicklungen der Klimakonferenzen seit Paris. Warum ist es wichtig, diesen Prozess fortzusetzen? Welche Fehlentwicklungen sind zu kritisieren? Welche Änderungen sind notwendig? Vorträge und Podiumsdiskussion Vorträge von: Dr. Susanne Götze (Publizistin, Redakteurin, Der Spiegel) Dr. Karsten Sach (Beirat der Stiftung Klimaneutrali-tät) Prof. Dr. Cathrin Zengerling (Umwelt und Natürliche Ressourcen, Freiburg) |
| Donnerstag 05.02.26 18 Uhr c.t. Aula KG I |
10 Jahre Pariser Klimaabkommen – Eine kritische Be-standsaufnahme – Teil 3 Themen: Warum verfehlen wir die in Paris beschlossenen Ziele? Welche Regime/Ordnungen/Politiken arbeiten dagegen? Welche politischen und finanzpolitischen Reformen wären nötig? Vorträge und Podiumsdiskussion Vorträge von: Prof. Dr. Stefan C. Aykut (Soziologie, insbesondere gesell-schaftliche Dynamiken der ökologischen Transformation, (CSS) Hamburg) Prof. Dr. Sabine Schlacke (Energie -, Umwelt- und Seerecht, Greifswald) |
| Donnerstag 23.04.26 16 Uhr c.t. Aula KG I |
Vorankündigung Sommersemester 2026 10 Jahre Pariser Klimaabkommen – Eine kritische Be-standsaufnahme – Teil 4 Themen: Klimagerechtigkeit? Welche Ausgleichsleistungen zwischen reichen und armen, verursachenden und leidenden Ländern sind nötig? Wie können sie erreicht werden (Stichwort: „Loss and damage“)? Vorträge und Podiumsdiskussion Vorträge von: Dr. Imme Scholz (Vorständin Heinrich Böll Stiftung) Prof. Dr. Anna-Katharina Hornidge (Globale Nachhaltige Entwicklung, Direktorin des IDOS, Bonn) tba |
Wahl-Webtalks - Baden-Württemberg wählt Die Landtagswahl 2026. Mobilisierungen. Mehrheiten. Möglichkeiten. Machtwechsel?
In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Freiburg und dem Carl-Schurz-Haus/Deutsch-Amerikanisches-Institut e.V.
Über die Reihe: Baden-Württemberg wählt: In welchem Zustand präsentiert sich der politische Motor unseres Landes, das Parlament? Was sind wahlentscheidende Themen und welche Koalitionsoptionen sind denkbar? Zunehmend werden Wahlen auf der Zielgeraden entschieden und die Zahl der „Last-Minute-Wählerinnen und Wähler“ hat in den letzten Jahren zugenommen. Bestimmen die Ängste der Menschen, wer Mehrheiten erringt oder gewinnen die Parteien, die eine Agenda der Hoffnung verbreiten?
Bei unseren spannenden Webtalks bilanzieren renommierte Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker sowie Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler die Parlamentsarbeit der letzten Legislaturpe-riode. Diskutieren Sie mit uns über mögliche Regierungswechsel, die zur Wahl stehenden Parteien und Personen und über die entscheidenden landespolitischen Weichenstellungen für die Zukunft von Baden-Württemberg. Wir freuen uns auf interessante Expertisen und spannende Einblicke in die politische Zukunft unseres Bundeslandes.
Alle Wahl-Webtalks finden online donnerstags um 18 Uhr s.t. statt. Anmeldung erforderlich unter https://www.lpb-freiburg.de/anmeldung-wahl-webtalk-ltw26
| Donnerstag 20.11.25 |
BW wählt: Deepfakes, Daten, Demokratie. Wie klug wählen wir mit KI? Max Mundhenke, KI-Entwicklung, Creative Technologist, AI-Developer & Consultant, Berlin |
| Donnerstag 27.11.25 |
BW wählt: Parteien. Programme. Positionen. Es sind doch eh alle gleich! Zum Parteienwettbewerb in Baden-Württemberg Prof. Dr. Marc Debus, Professur für Politikwissenschaft, Vergleichende Regierungslehre, Fakultät Sozialwissenschaften, Universität Mannheim |
| Donnerstag 04.12.25 |
BW wählt: Stagnation? Stillstand? Stabilität? Eine Analyse zentraler Politikfelder nach zehn Jahren Grün-Schwarz in Baden-Württemberg. Prof. Dr. Uwe Wagschal, Seminar für wissenschaftliche Politik, Universität Freiburg |
| Donnerstag 15.01.26 |
BW wählt: Wählen. Wen? Warum? Was bewegt Baden-Württemberg?
|
| Donnerstag 22.01.26 |
BW wählt: Landespolitik. Langeweile. Leidenschaft. Lethargie? Mit Landesjournalistinnen im Gespräch Annika Grah, Themenkoordinatorin, Stuttgarter Zeitung Filiz Kuekrekol-Koch, Redakteurin SWR Landespolitik, Stuttgart |
| Donnerstag 29.01.26 |
BW wählt: Wahlkämpfe. Wandel. Wähleransprachen. Prof. Dr. Frank Brettschneider, Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, insbesondere Kommunikationstheorie, Universität Hohenheim |
| Donnerstag 05.02.26 |
BW wählt jung: Next Gen Politics. Warum Politik junge Menschen braucht. Diskussion mit jungen Kandidierenden und Landtagsabgeordneten
|
Gemeinsinn in der Krise – Politik zwischen politischem Urteilen und Populismus
In Zusammenarbeit mit PD Dr. Martin Baesler, unterstützend begleitet von Prof. em. Dr. Gisela Riescher, Professur für Politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte am Seminar für Wissenschaftliche Politik in Kooperation mit dem Colloquium Politicum
Über die Reihe: In einer Zeit, in der politische Gewissheiten erodieren, die Gefahr des Populismus wächst und immer wieder eine „Krise der Demokratie“ diagnostiziert wird, rückt die Bedeutung des Gemeinsinns sowie eines reifen, verantwortungsvollen und kontextsensiblen Urteilens in den Vorder-grund. Die Reihe geht der Frage nach, welche Rolle dem Gemeinsinn in gesellschaftlichen Krisen- und Umbruchssituationen zukommt, einerseits als Ressource politischer Freiheit und menschlicher Wirksamkeit, andererseits als Konzept, das durch populistische und autoritäre Strömungen unterwan-dert und in seiner reflektiven Kraft geschwächt werden kann. Der thematische Rahmen eröffnet philosophische, politiktheoretische und ideengeschichtliche Perspektiven auf die Frage, wie gesellschaftliche und politische Ordnungen sich erhalten und wie sie durch Urteilskraft erneuert werden können.
|
Montag 15.12.25 |
Prof. Dr. Hans-Jörg Sigwart Das gegenwärtige gesellschaftliche Debattenklima wird vielfach als durch zunehmende Polarisierung und Fragmentierung und in Folge durch einen zunehmenden Mangel an praktiziertem bürgerschaftlichem Gemeinsinn charakterisiert beschrieben. Ob Klimawandel, Rechtspopulismus oder Sicherheits- und Verteidigungsfragen – überall scheinen sich diametral entgegengesetzte Positionen innerhalb der Zivilgesellschaft gegenüberzustehen. Zugleich scheinen die Voraussetzungen für einen konstruktiven politischen Streit zwischen ihnen zu erodieren. Der Vortrag nimmt vor diesem Hintergrund das politiktheoretische Grundkonzept der „Meinung“ in den Blick: Welche Rolle spielt die bürgerschaftliche Praxis des „Meinens“ für die Konstitution und Reproduktion von Gemeinsinn in öffentlichen Diskursen? Wie lässt sich die öffentliche Rolle von Meinungen in ihrem Verhältnis zu „Wissen“, aber auch zu öffentlichen Formen der „Moral“ genauer bestimmen? Und lassen sich politisch konstruktive Formen des Meinens von problematischen, destruktiven Formen politischer Meinungsbildung unterscheiden? |
| Fällt aus! |
ABGESAGT - Prof. Jennifer Culbert (Johns Hopkins University, Baltimore) A Crisis of Common Sense: Revaluing the Right to Define Our Own Worlds of Meaning Über den Vortrag: In “What is Authority?” (1954), Hannah Arendt famously suggests that in discussions among political and social scientists there is “a silent agreement” that “we can ignore distinctions and proceed on the assumption that everything can eventually be called anything else, and that distinctions are meaningful only to the extent that each of us has the right ‘to define his terms.’” Under such circumstances, she claims, if “we assure ourselves we still understand each other, we do not mean that together we understand a world in common to us all, but that we understand the consistency of arguing and reasoning.” In brief, while we silently agree on something, what we agree on is not an understanding of the world in which we find ourselves individually but on a right to occupy “our own worlds of meaning.” In this lecture, I focus on the assumption of such a right. I argue that this right is conflated with “the right to have rights,” a conflation that Arendt herself invites in her comments in The Origins of Totalitarianism on a right to belong to some kind of organized community. In order to elaborate further on Arendt’s own suggestion in “What is Authority?” that only now with the loss of tradition and the cutting of the ties that bind us to these communities “will the past open up to us with unexpected freshness and tell us things no one has yet had ears to hear,” the lecture concludes by interrogating Arendt’s view of rights, complicating Arendt’s claims about community, and emphasizing the way in which words resist the efforts of men to define them for themselves. (Text: Jennifer Culbert) |
| Montag 19.01.26 18 Uhr c.t. HS 1098 KG I |
Prof. Dr. Eva Marlene Hausteiner
|
| Montag 26.01.26 18 Uhr c.t. Aula KG I |
Prof. John Dunn (King's College, University of Cambridge) The History of Political Thought as Window on the World Über den Vortrag: Everyone understands politics through their own life. My own life has shaped my vision of politics accordingly, but for over sixty years it has reshaped it extensively through thinking about the history of human political thinking. The portion of that history I have studied has been principally the political thinking of the west, more or less from the days of Socrates to the second Trump Presidency. In this lecture, I will trace how living through politics and studying its history have intersected in my own life, and why discoveries in the history of political thought continue to matter for how we live and understand our present. (Text: John Dunn) |
American Rodeo: Die USA zwischen Show und Schicksal
In Zusammenarbeit mit Carl-Schurz-Haus/Deutsch-Amerikanisches-Institut e.V. und der Landeszentrale für Politische Bildung Freiburg
Über die Reihe: In den westernhaften politischen Weiten der USA bockt die Demokratie. Die Ultrareichen züchten sich ihre eigenen Gesetzgeber, und radikale Ideen schießen schneller aus dem Halfter, als wir „Midterm“ sagen können. „American Rodeo“ bringt Sie mitten hinein in den postfaktischen Sandsturm eines Landes, das unter „Trump: Reloaded“ zur Dauer-Show geworden ist: laut, aufgeladen, unberechenbar. „American Rodeo“ ist kein gemütlicher Country-Abend: Es ist die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem aktuellen Polit-Spektakel über Macht, Mythos und Medien in den USA. (Text: CSH)
| Mittwoch 05.11.25 19 Uhr s.t. HS 1199 KG I |
Young Voters One Year After the US-Election Podiumsdiskussion mit jungen US-Erstwählerinnen und -wählern ein Jahr nach der US-Wahl |
| Dienstag 18.11.25 19 Uhr Max-Kade-Saal I |
American Aftermaths: A Journey Through the South Bildervortrag von Prof. Dr. Eva Ulrike Pirker, Vrije Universiteit Brussel |
| Donnerstag 20.11.25 19 Uhr UWC Robert Bosch College, Kartäuserstr. 119 |
Blackouts Lesung & Gespräch mit Justin Torres, Los Angeles (UCLA): Einlass nur mit Ticket. Erhältlich via csh-fr.de. |
| Dienstag 02.12.25 19 Uhr HS 1199 KG I |
Liebe! Ein Aufruf Lesung & Gespräch mit Daniel Schreiber, Berlin Einlass nur mit Ticket. Erhältlich via Buchhandlung Rombach. |
| Freitag 16.01.26 19.30 Uhr Literaturhaus Freiburg, Bertoldstraße 17 |
Zerstörungslust: Elemente des demokratischen Faschismus Buchvorstellung & Gespräch mit Dr. Carolin Amlinger & Prof. Dr. Oliver Nachtwey, Universität Basel Einlass nur mit Ticket. Erhältlich via Literaturhaus Freiburg. |
| Donnerstag 22.01.26 19 Uhr HS 1098 KG I |
Goodbye, Amerika? Die USA und wir – eine Neuvermessung |
| Donnerstag 29.01.26 19 Uhr HS 1098 KG I |
Podiumsdiskussion: Aktuelle Migrationsfragen im transatlantischen Vergleich (Arbeitstitel) Für aktuelle Informationen s. Homepage Colloquium politicum |
Freiburg und die Region in der Zeit des Nationalsozialismus. Versuch einer lokalen und regionalen Bestandsaufnahme – Teil 9
In Zusammenarbeit mit: Landeszentrale für politische Bildung Freiburg; Städtische Museen Freiburg; Dokumentationszentrum Nationalsozialismus Freiburg; Gedenkstätten Südlicher Oberrhein; Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg
Die von den Nationalsozialisten erzwungene Stärkung der „Volksgemeinschaft“ bedeutete auch in Freiburg und in der Region die Verdrängung und Verfolgung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs soll an Beispielen untersucht werden, wie weit die beteiligten Akteure und die Stadt Freiburg ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus aufgearbeitet haben.
Die Webtalks beleuchten die NS-Zeit aus unterschiedlichsten Perspektiven und fragen nach den – teilweise unvollständigen oder widersprüchlichen – „Erinnerungsfiguren" (Jan Assmann), die das Selbstverständnis und die Erinnerungskultur in Freiburg und der Region bis heute maßgeblich prägen.
Moderation:
- Julia Wolrab, Wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus der Städtischen Museen Freiburg
- Jost Großpietsch, Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkinitiativen in Baden-Württemberg (LAGG)
Termine: Wenn nicht anders angegeben jeweils mittwochs, ab 20.15 Uhr
Virtueller Ort: https://meet.freiburg.de/b/jul-dnq-rkm-soq (BigBlueButton)
| Mittwoch 05.11.25 20 Uhr c.t. |
Claudius Heitz (Historiker und Lehrer mit Schüler:innen der Geschichts-AG des Kollegs St. Sebastian, Stegen) Im Zweiten Weltkrieg über den Rhein. Badische Siedler im Elsass. |
|
Mittwoch |
Dr. Ercüment Çelik (Soziologe mit den Forschungsschwerpunkten der Arbeits- und Entwicklungssoziologie sowie Wissenszirkulation zwischen Europa und dem Globalen Süden an der Universität Freiburg) Exil Türkei, 1933-1945: Erinnerungen an vertriebene Wissenschaftler:innen der Universität Freiburg in der Zeit des Nationalsozialismus |
| Mittwoch 14.01.26 20 Uhr c.t. |
Dr. Nicola Hanefeld |