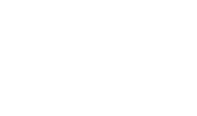Rainer Maria Rilke. Eine Hommage zum 150. Geburtstag des Dichters

An der Jahreswende 2025/26 berühren sich zwei bedeutende Rilke-Jubiläen: Am 4. Dezember 2025 jährt sich der Geburtstag des 1875 in Prag geborenen Dichters zum 150. Mal, am 29. Dezember 1926, vor 100 Jahren, ist er mit 51 Jahren in Montreux gestorben. Das Studium generale gedenkt des großen Schriftstellers und Lyrikers mit einem Zyklus aus sieben Vorträgen und einem Rezitationsabend, der an wichtige Stationen des Werkes erinnern, nach Rilkes fortdauernder Wirkung fragen und zu erneuter Lektüre ermutigen will.
Die Vorträge der Reihe werden aufgezeichnet und zeitversetzt hier über Links bei den einzelnen Vorträgen und gesammelt auf dem Medienportal des Studium generale zugänglich gemacht.
Achtung Raumänderung:
Mittwoch / 20 Uhr c.t. / HS 1010 (Kollegiengebäude I)
Prof. Dr. Sandra Richter
(Direktorin, Deutsches Literaturarchiv Marbach a.N.)
„Du mußt das Leben nicht verstehen“, oder: Rilke und seine Umwelt im Werk
Mittwoch, 26.11.25
 Rilke versuchte, das Leben zu deuten, und sprach sich doch vom Sinn solcher Deutungen frei. Vielmehr suchte er seinen jeweiligen „Bezug“, wie er es nannte. In diesem Vortrag, der zugleich einen Überblick geben will, soll es um das Spannungsverhältnis gehen, das solche Bezüge zu Rilkes Umwelt aufweisen, im Leben und im Werk.
Rilke versuchte, das Leben zu deuten, und sprach sich doch vom Sinn solcher Deutungen frei. Vielmehr suchte er seinen jeweiligen „Bezug“, wie er es nannte. In diesem Vortrag, der zugleich einen Überblick geben will, soll es um das Spannungsverhältnis gehen, das solche Bezüge zu Rilkes Umwelt aufweisen, im Leben und im Werk.
Ullo von Peinen (Freiburg), Rezitation & Ursula Meyer (Berlin), Klavier
„Ich lerne sehen – ja, ich fange an“: Ein Rezitationsabend zum 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke mit Musik von Claude Debussy
Donnerstag, 04.12.25, 19.30 Uhr | Archäologische Sammlung, Herderbau
Eintritt frei.
Kostenlose Eintrittskarten (max. zwei pro Person) können ab sofort bei Rainer Dausch im Studium generale abgeholt werden (Belfortstr. 20, 1. OG, täglich von 10-16 Uhr).
 Am 150. Geburtstag des Dichters laden der Freiburger Schauspieler und Rezitator Ullo von Peinen
Am 150. Geburtstag des Dichters laden der Freiburger Schauspieler und Rezitator Ullo von Peinen und die Berliner Pianistin Ursula Meyer ein zu einer poetisch-musikalischen Soirée mit Prosa und Lyrik Rainer Maria Rilkes und Klavierkompositionen von Claude Debussy im kongenialen Ambiente der Archäologischen Sammlung der Universität im Herderbau. Obwohl beide Künstler-Zeitgenossen, der Dichter und der Komponist, sich mutmaßlich nie persönlich begegnet sind, vermitteln ihr imaginäres Zusammenspiel und die Verflechtung ihrer künstlerischen Idiome eine suggestive Vorstellung von der Kühnheit, der Stimmenvielfalt und den Suchbewegungen der Künste auf dem Weg vom Fin de Siècle zur klassischen Moderne.
und die Berliner Pianistin Ursula Meyer ein zu einer poetisch-musikalischen Soirée mit Prosa und Lyrik Rainer Maria Rilkes und Klavierkompositionen von Claude Debussy im kongenialen Ambiente der Archäologischen Sammlung der Universität im Herderbau. Obwohl beide Künstler-Zeitgenossen, der Dichter und der Komponist, sich mutmaßlich nie persönlich begegnet sind, vermitteln ihr imaginäres Zusammenspiel und die Verflechtung ihrer künstlerischen Idiome eine suggestive Vorstellung von der Kühnheit, der Stimmenvielfalt und den Suchbewegungen der Künste auf dem Weg vom Fin de Siècle zur klassischen Moderne.
Prof. Dr. Fred Lönker
(Deutsches Seminar, Universität Freiburg)
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1904-1910) – Rilkes poetische Anthropologie der Moderne
Mittwoch, 10.12.25
 Rilkes zwischen 1904 und 1910 entstandener Tagebuchroman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge gehört sicher zu den bedeutend-sten Prosatexten des 20. Jahrhunderts. Der gerade in Paris angekommene Malte begegnet einer Großstadtwirklichkeit, deren Schrecken er sich hilflos ausgesetzt fühlt. Der Versuch, sie schreibend zu bewältigen, wird zunächst zum Auslöser von Erinnerungen an die eigene angsterfüllte Kindheit, später aber wird der Themenkreis um historische und biblische Reminiszenzen erweitert. Dabei wird ein Anspruch formuliert, der geradezu maßlos ist. Die ganze Weltgeschichte sei missverstanden worden, alles Reden über die Welt sei an der Oberfläche des Lebens geblieben und müsse korrigiert werden. Was die Aufzeichnungen schließlich bieten, ist nichts weniger als eine Anthropologie. Diese Anthropologie liefert jedoch keine abstrakten Einsichten, sondern demonstriert an für Malte gleichsam archetypischen Situationen elementare menschliche Selbst- und Weltverhältnisse.
Rilkes zwischen 1904 und 1910 entstandener Tagebuchroman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge gehört sicher zu den bedeutend-sten Prosatexten des 20. Jahrhunderts. Der gerade in Paris angekommene Malte begegnet einer Großstadtwirklichkeit, deren Schrecken er sich hilflos ausgesetzt fühlt. Der Versuch, sie schreibend zu bewältigen, wird zunächst zum Auslöser von Erinnerungen an die eigene angsterfüllte Kindheit, später aber wird der Themenkreis um historische und biblische Reminiszenzen erweitert. Dabei wird ein Anspruch formuliert, der geradezu maßlos ist. Die ganze Weltgeschichte sei missverstanden worden, alles Reden über die Welt sei an der Oberfläche des Lebens geblieben und müsse korrigiert werden. Was die Aufzeichnungen schließlich bieten, ist nichts weniger als eine Anthropologie. Diese Anthropologie liefert jedoch keine abstrakten Einsichten, sondern demonstriert an für Malte gleichsam archetypischen Situationen elementare menschliche Selbst- und Weltverhältnisse.
Dr. Gunilla Eschenbach
(Deutsches Literaturarchiv Marbach a.N.)
Rilke zeichnet
Mittwoch, 17.12.25
 Rilke galt bislang als Textkünstler. Doch der junge Rilke wurde durch das Zeichnen zum Künstler. Schon als Vierjähriger schuf er zeichnend eigene Welten, noch lang vor der Phase des Schriftspracherwerbs. Der spätere Autor ließ sich oft von visuellen Eindrücken leiten. Er kombinierte in seinen Notizbüchern Text und Bild und hielt flüchtig skizzierend fest, was ihn faszinierte: eine Blume, ein Kunstwerk, der Flug einer Taube. In den Beständen des Deutschen Literaturarchivs sind heute etwa 320 Zeichnungen Rilkes überliefert; 200 davon in Notizbüchern, viele weitere als Einzelblätter, einige wenige in Briefen oder in Büchern. Seine bislang unbekannten Zeichnungen zeigen ihn als einen multimedial arbeitenden Künstler. Den Autor Rilke gäbe es ohne den Zeichner Rilke nicht, aber der Autor Rilke wollte das verschweigen, womöglich, um dem Bild in seinem bildhaften Schreiben Raum zu geben.
Rilke galt bislang als Textkünstler. Doch der junge Rilke wurde durch das Zeichnen zum Künstler. Schon als Vierjähriger schuf er zeichnend eigene Welten, noch lang vor der Phase des Schriftspracherwerbs. Der spätere Autor ließ sich oft von visuellen Eindrücken leiten. Er kombinierte in seinen Notizbüchern Text und Bild und hielt flüchtig skizzierend fest, was ihn faszinierte: eine Blume, ein Kunstwerk, der Flug einer Taube. In den Beständen des Deutschen Literaturarchivs sind heute etwa 320 Zeichnungen Rilkes überliefert; 200 davon in Notizbüchern, viele weitere als Einzelblätter, einige wenige in Briefen oder in Büchern. Seine bislang unbekannten Zeichnungen zeigen ihn als einen multimedial arbeitenden Künstler. Den Autor Rilke gäbe es ohne den Zeichner Rilke nicht, aber der Autor Rilke wollte das verschweigen, womöglich, um dem Bild in seinem bildhaften Schreiben Raum zu geben.
Prof. Dr. Werner Frick
(Deutsches Seminar, Universität Freiburg)
In der Schule des Sehens: Rilkes Neue Gedichte (1907) und Der Neuen Gedichte anderer Teil (1908)
Mittwoch, 07.01.26

Die beiden 1907 und 1908 veröffentlichten Sammlungen Neue Gedichte und Der Neuen Gedichte anderer Teil gelten zusammen mit den 1910 publizierten Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge als Hauptwerke von Rilkes mittlerer Schaffensperiode. In diesen (überwiegend in Paris entstandenen) Zyklen, die viele der bis heute bekanntesten Gedichte des Autors enthalten – Der Panther, Das Karussell (Jardin du Luxembourg), Archaïscher Torso Apollos, Römische Fontäne, L’Ange du Méridien (Chartres), Blaue Hortensie, Die Flamingos, Der Ball, Selbstbildnis aus dem Jahre 1906 u.v.a. –, gelangt Rilkes dichterische Sprache in ihr Eigenstes und zu ihrer Version lyrischer Modernität als einer ‚Schule des Sehens‘. In textnahen Lektüren wird der Vortrag in diese Galerie exquisiter Gedichte auf Pflanzen, Tiere, Artefakte einführen und einige ihrer wesentlichen Bezüge erläutern: Rilkes aemulatio mit Vorbildern der Bildenden Kunst (von antiken Skulpturen und gotischen Kathedralen bis zu Rodin, Cézanne, van Gogh und Paula Modersohn-Becker), seine quasi-phänomenologische Adaptation von Formtraditionen des Stilllebens und des ‚Dinggedichts‘, seine Nähe zu Positionen des Symbolismus und Imagismus, vor allem aber: seine Thematisierung des Sehens und Schauens, Wahrnehmens und Wahrgenommen-Werdens als eines ästhetischen, ethischen und existentiellen Aktes der Anverwandlung der Welt und ihres Widerklingens im „Weltinnenraum“ der Poesie.
Prof. Dr. Mario Zanucchi
(Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Salerno)
„Tempel im Gehör“ – Antiker Mythos und poetologische Neudeutung in Rilkes Sonetten an Orpheus (1922)
Mittwoch, 14.01.26

Orpheus ist der archetypische Mythos, der die unbegrenzte Macht der Poesie feiert. In seinen als poetisches Epitaph für die verstorbene junge Tänzerin Wera Ouckama Knoop entstandenen Sonetten an Orpheus, die als Meisterwerk der modernen Lyrik gelten, transformiert Rilke den mythischen Ur-Sänger in eine Projektionsfläche für die eigene Poetik. Der Vortrag wird zunächst die Hauptstationen des antiken Orpheus-Mythos in Literatur und Ikonographie umreißen und sich dann der Spezifik von Rilkes Orphismus zuwenden, der die Sterblichkeitserfahrung durch die ‚Verwandlung‘ des Vergänglichen in Gesang als Ausdruck einer allumfassenden Lebensimmanenz einfängt. Andererseits wird sich auch zeigen, dass Rilkes Orpheus kein areligiöser Dichter-Gott ist, sondern – in Nietzsches Nachfolge – einen ‚Anti-Christus‘ verkörpert, dessen esoterische Heilslehre von einer Umwidmung zentraler christlicher Konzepte profitiert.
Prof. Dr. Elisabeth Cheauré
(Slavisches Seminar und Zwetajewa-Zentrum e.V. an der Universität Freiburg)
Rilke – ein ‚Russlandversteher‘? Verklärende Reisen, erstaunliche Texte und die bemerkenswerte Liebe zu Marina Zwetajewa
Mittwoch, 21.01.26
 „Dass Russland meine Heimat ist, gehört zu jenen großen und geheimnisvollen Sicherheiten, aus denen ich lebe.“ Rilke reiste in den Jahren 1899 und 1900 zweimal ins damalige Zarenreich und war, wie diese emphatische Äußerung zeigt, von Russland tief beeindruckt, ja so begeistert, dass ihm noch über hundert Jahre später das heute anrüchige Etikett eines ‚Russlandverstehers‘ angeheftet wurde. Er lernte Russisch und schrieb sogar einige Gedichte in dieser Sprache. Aber was hat Rilke von Russland wirklich ‚verstanden‘, wie und von wem wurde seine Wahrnehmung gelenkt und welche Spuren hat die Begeisterung für Russland in seinem Werk hinterlassen? Diesen Fragen wird der Vortrag nachgehen. Und nicht zuletzt gilt es das besondere Verhältnis zwischen Rilke und Marina Zwetajewa zu beleuchten, jener berühmten russischen Dichterin, die biographisch eng mit Freiburg verbunden ist.
„Dass Russland meine Heimat ist, gehört zu jenen großen und geheimnisvollen Sicherheiten, aus denen ich lebe.“ Rilke reiste in den Jahren 1899 und 1900 zweimal ins damalige Zarenreich und war, wie diese emphatische Äußerung zeigt, von Russland tief beeindruckt, ja so begeistert, dass ihm noch über hundert Jahre später das heute anrüchige Etikett eines ‚Russlandverstehers‘ angeheftet wurde. Er lernte Russisch und schrieb sogar einige Gedichte in dieser Sprache. Aber was hat Rilke von Russland wirklich ‚verstanden‘, wie und von wem wurde seine Wahrnehmung gelenkt und welche Spuren hat die Begeisterung für Russland in seinem Werk hinterlassen? Diesen Fragen wird der Vortrag nachgehen. Und nicht zuletzt gilt es das besondere Verhältnis zwischen Rilke und Marina Zwetajewa zu beleuchten, jener berühmten russischen Dichterin, die biographisch eng mit Freiburg verbunden ist.
Prof. Dr. Achim Aurnhammer
(Deutsches Seminar, Universität Freiburg)
Zwischen Klage und Zustimmung: Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien (1923)
Mittwoch, 28.01.26
HS 1010

Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien, 1912 begonnen, 1922 vollendet und 1923 veröffentlicht, zählen zu den anspruchsvollsten lyrischen Werken der deutschen Literatur. In dem formalästhetisch wie inhaltlich kohärenten Zyklus ermisst Rilke „die Reichweite des menschlichen Fühlens“ (Gadamer) und stellt die existentiellen Fragen von Liebe, Leben und Tod. So präsentieren die zehn Elegien eine poetische Analyse der ‚condition humaine‘ und ziehen zugleich im Prinzip der „Verwandlung“ die Scheingewissheiten der „gedeuteten Welt“ der Moderne in Zweifel. Neben der Gesamtstruktur und Dynamik des Zyklus sollen ausgewählte Elegien und exemplarische Textstellen besprochen und nach einem übergreifenden Aussagegehalt gesucht werden.