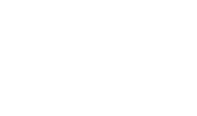Samstags-Uni: Dimension ‚Zeit‘: Temporalität in Wissenschaft, Kunst, Kultur und Gesellschaft

„Denn was ist Zeit? Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer es denkend erfassen, um es dann in Worten auszudrücken? Und doch – können wir ein Wort nennen, das uns vertrauter und bekannter wäre als die Zeit? Wir wissen genau, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, verstehen’s auch, wenn wir einen andern davon reden hören. Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß ich’s nicht.“ Die berühmten Sätze aus dem XI. Buch der Bekenntnisse (397-401 n.Chr.) des Augustinus drücken es aus: Die Zeit ist ein Faszinosum eigener Art, ebenso omnipräsent wie rätselhaft, alle Lebens- und Wirklichkeitsbereiche im Rhythmus des Werdens und Vergehens durchdringend und bestimmend, dennoch schwer zu begreifen. Auch die Samstags-Uni des Wintersemesters 2024/25 wird diese Rätsel nicht lösen. Aber sie sucht die Dimension ‚Zeit‘ und das Phänomen der Temporalität aus vielen disziplinären Blickwinkeln zu erfassen: von den langen Zeitachsen der Kosmologie, der Geologie, der biologischen Evolution und der Kulturgeschichte über Fragen der physikalischen Zeitmessung, der subjektiven oder generationsübergreifenden Zeiterfahrung, des gesellschaftlichen Zeitdrucks und Zeitmanagements in den beschleunigten Lebensverhältnissen unserer Tage bis hin zur Reflexion temporaler Verhältnisse in den Zeitkonstruktionen von Sprache, Kunst, Musik und Literatur.
Die Vorträge finden samstags zwischen 11:15 Uhr und 12:45 Uhr in Präsenz im HS 1010 im Kollegiengebäude I der Universität statt und können kostenlos und ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Alle Vorträge der Reihe werden außerdem aufgezeichnet und zeitversetzt hier über Links bei den einzelnen Vorträgen und gesammelt auf dem Medienportal des Studium generale zugänglich gemacht.
Samstag / 11 Uhr c.t. / HS 1010 (Kollegiengebäude I)
Prof. Dr. Oskar von der Lühe
(Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik, Freiburg/ Physikalisches Institut, Universität Freiburg)
Zeit und das Universum – vom Urknall bis zur heutigen Kosmologie
Samstag, 19.10.24

Das Universum existiert – nach heutigem Stand des Wissens – seit etwas mehr als 13 Milliarden Jahren und fand seinen Anfang in einem singulären Ereignis, genannt der Urknall. Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse der modernen Physik ist es, dass Raum und Zeit selbst, also der Konfigurationsraum, in welchem physikalische Ereignisse stattfinden, zumindest einen Anfang hatten. Raum und Zeit sind nicht unendlich.
Dieser Vortrag beschreibt und erläutert die Entdeckungen und Erkenntnisse, die seit etwa einhundert Jahren zu dem gegenwärtigen Stand der Kosmologie geführt haben. Die Grundlagen sind die allgemeine Relativitätstheorie Albert Einsteins und darauf aufbauende Arbeiten sowie die zahllosen Beobachtungen des Universums jenseits unserer Milchstraße seit Edwin Hubble und die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Moderne Teleskope und Instrumente auf dem Erdboden und im Weltraum haben in den vergangenen Jahrzehnten unseren Wissensstand erheblich erweitert und zu einer weitgehend konsolidierten Vorstellung über unseren Kosmos geführt. Trotzdem gibt es noch viele offene Fragen.
Prof. Dr. Ralf Reski
(Pflanzenbiotechnologie, Fakultät für Biologie, Universität Freiburg)
Die langen Zeitlinien der Evolution
Samstag, 26.10.24

Getreu dem Motto des ukrainisch-US-amerikanischen Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky „Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn außer im Licht der Evolution“ beleuchtet der Vortrag die Grundlagen der Evolution und ihre Bedeutung für die Welt, in der wir heute leben. Die Reise entlang der langen Zeitlinien der Evolution beginnt mit der Entstehung des Lebens auf der Erde vor etwa 3,5 Milliarden Jahren und der anschließenden Entwicklung zellulärer und multizellulärer Lebewesen. Weitere Stationen sind die Erfindung der Photosynthese, die Eroberung der urtümlichen, kargen Landmassen durch Pflanzen vor 500 Millionen Jahren, das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren und die nachfolgende komplexe Menschwerdung. Die Reise wird enden mit einem winzigen Moos, das vor 400 Millionen Jahren entstand und seinen Rückzugsort in der tibetischen Hochebene, dem Dach der Welt, gefunden hat. Dieses lebende Fossil ist nun von der Erderwärmung in seiner Existenz bedroht, da menschengemachter Klimawandel und biologische Evolution auf unterschiedlichen Zeitskalen verlaufen.
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Auer
(Deutsches Seminar, Abt. Germanistische Linguistik, Universität Freiburg)
Die Zeit der Sprache
Samstag, 02.11.24

Ist der ‚Begriff‘ von Zeit, der sich in die Strukturen der Sprache(n) eingeschrieben hat, eigentlich derselbe lineare Zeitbegriff, der die europäische Moderne prägt? Und haben alle Sprachen denselben linearen ‚Begriff‘ von Zeit? Gibt es Sprachen, die ihren Nutzern gar keine Ausdrucksformen für Zeit zur Verfügung stellen oder deren Zeitsystem eine nicht-lineare, zyklische Vorstellung von Zeit widerspiegelt? Wenn das der Fall ist, prägen die unterschiedlichen Zeitsysteme der Sprachen dann das Denken der Sprecher und Sprecherinnen, so dass diese in bestimmten Vorstellungen von Zeit verfangen (oder sogar gefangen) sind? – Um bei solch komplexen Fragen nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und in Spekulationen abzudriften, ist es nötig, (a) die sprachlichen Mittel genauer zu beschreiben, mit denen Sprache Zeit ausdrückt, (b) sich eine Vorstellung davon zu machen, in welchen Grenzen die Zeitsysteme in den Sprachen der Welt verschieden sein können und (c) zu überlegen, wie die Beziehung zwischen Sprache und Denken überhaupt gefasst werden kann. – All das soll in dem Vortrag erfolgen. Bei der genaueren Analyse wird sich zeigen, dass Zeit in der Sprache nicht sinnvoll analysiert werden kann, wenn nicht auch berücksichtigt wird, dass Sprache in der Zeit stattfindet, nämlich in der Zeitlichkeit des Diskurses.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Joachim Gehrke
(Seminar für Alte Geschichte, Universität Freiburg)
Die Zeit der Geschichte und die Uhr des Historikers
Samstag, 09.11.24

Zeit ist die zentrale Kategorie der Geschichte. Deshalb müssen wir uns nicht darüber wundern, dass alle Kulturen, die wir näher kennen, ihre eigenen Formen des Umgangs mit Zeit entwickelt haben. Beispielen für solche Formen widmet sich der erste Teil des Vortrags. Dort werden vor allem verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen Menschen in vergangenen Epochen die Zeit gemessen haben, bis hin zu den Grundlagen unseres eigenen Kalenders, der über die Römer und Griechen auf ägyptische Wurzeln zurückgeht. Davon ausgehend dokumentiert der zweite Teil die Verfahren und Konzepte, mit denen moderne Historiker die verschiedenen Aspekte der Zeit und ihres Ablaufs über lange Zeiträume, über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, erfassen, von der schlichten Chronologie bis hin zu komplexen Rhythmen und Verlaufsformen.
Prof. Dr. Dr. Norman Sieroka
(Institut für Philosophie, Abt. Theoretische Philosophie, Universität Bremen)
Philosophie der Zeit: Vielfalt, Grundtypen und Koordination von Zeitlichem
Samstag, 16.11.24

Zeit ist eine grundlegende Dimension für uns und bietet uns Orientierung – egal, ob wir Menschen als biologisch-physikalische oder als geistige Wesen betrachten. Entsprechend beschäftigt sich eine Vielzahl nicht nur akademischer Disziplinen mit Fragen nach der Zeit in unterschiedlichen Erscheinungsformen: als physikalische Zeit, als individuell erlebte oder psychologische Zeit, als gesellschaftlich-intersubjektive Zeit, als grammatische Zeitform, als historische Zeit u.v.m. Allerdings werden selten die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Verbindungen dieser Diskussionen aufgezeigt. Hier kann die Philosophie eine wichtige Koordinationsaufgabe übernehmen. Und so wird es in diesem Vortrag unter anderem darum gehen, ob es allgemeine Grundtypen von Zeitordnungen gibt und warum „die Zeit“ kein eigenständiger Gegenstand ist, sondern vielmehr mit Verhältnissen und Taktungen zu tun hat – und warum Musik und Hören helfen können, Zeit „besser zu verstehen“.
Prof. Dr. Vera King
(Institut für Soziologie, Goethe-Universität Frankfurt a.M./ Sigmund-Freud-Institut Frankfurt a.M.)
Zeit im Generationenverhältnis: Generative Weitergabe zwischen Wiederholung und Neubeginn
Samstag, 23.11.24
(Für diesen Vortrag können wir leider keinen Mitschnitt anbieten.)
In Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg

Die Zeit der Generationen übersteigt die individuelle Endlichkeit und bildet eine Brücke über „Lebenszeit und Weltzeit“ (Blumenberg). Die Fortsetzung der Generationenlinie kann daher einerseits Trost bieten, andererseits bereitet jede Generation, die sich kümmert und Nachfolger ausbildet, auch ihre künftige Ablösung mit vor – ein ambivalenter Prozess. Doch nur durch eine überwiegend konstruktive generationale Weitergabe in Familie und Institutionen, durch ‚Generativität‘ auch im Sinne verantwortungsvoller Sorge, wird eine lebbare Zukunft der Nachkommen ermöglicht. Zugleich verändern sich die Voraussetzungen im Generationenverhältnis durch raschen gesellschaftlichen Wandel, Optimierungsstreben und Beschleunigung des Lebenstempos. Der Vortrag thematisiert Bedingungen, aber auch Krisen der Generativität und zeitgenössische Konflikte der Weitergabe zwischen Wiederholung, Beschleunigung und Neubeginn.
Prof. Dr. Annegret Wilde
(Molekulare Genetik, Fakultät für Biologie, Universität Freiburg)
Wie können Bakterien die Zeit messen?
Samstag, 30.11.24

Unsere Erde rotiert einmal in 24 Stunden um ihre eigene Achse und bestimmt so den Tag-Nacht-Wechsel. Pflanzen und Tiere können diesen Rhythmus vorhersagen, da sie eine genetisch festgelegte innere Uhr besitzen. Am deutlichsten wird uns diese innere Uhr bei Fernreisen bewusst, wenn wir unter einem Jetlag leiden. Dann behält unsere innere Uhr für eine Weile den alten Rhythmus bei, passt sich jedoch allmählich der neuen Zeitzone an. Wie aber ist es bei Bakterien, die sich schneller als einmal am Tag teilen können? Und warum sollten Bakterien überhaupt eine innere Uhr benötigen? Studien zeigen, dass auch manche Bakterien einen inneren Rhythmus haben, der es ihnen ermöglicht, den Anbruch von Tag und Nacht vorherzusehen. Dies hilft ihnen, sich optimal an ihre Umgebung anzupassen. Mithilfe molekularer Methoden ist man den Mechanismen der bakteriellen inneren Uhr auf der Spur.
Prof. Dr. Angeli Janhsen
(Kunstgeschichtliches Institut, Universität Freiburg)
Zeit als Thema neuer Kunst bei On Kawara, Roman Opalka und Peter Dreher
Samstag, 07.12.24
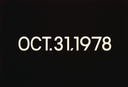
In der älteren Kunst ist Zeit zum Beispiel in Stillleben oder Historienbildern Thema. Heute gibt es neue Formen und andere Interessen. In Freiburg sind Peter Drehers (1931 – 2020) Bilder mit dem Titel „Tag um Tag guter Tag“ vielleicht am bekanntesten – das von ihm immer wieder gemalte Glas sieht hunderte und tausende von Malen immer neu aus. Der französisch-polnische Künstler Roman Opalka (1931 – 2011) malt in seiner Lebenszeit immer fortlaufende Zahlen. Der wohl berühmteste Zeitkünstler ist der Japaner On Kawara (1933 – 2014). Mit seinen vielen „Date Paintings“ und seinen großen Arbeiten „One Million Years Past“ und „One Million Years Future“ macht er Einsichten möglich, die dem heute üblichen Umgang mit Zeit entsprechen – und gleichzeitig die Verrücktheit des Alltäglichen zeigen.
Prof. Dr. Christian Leibold
(Theoretische Systemneurowissenschaften, Fakultät für Biologie, Universität Freiburg)
Schnelle zelluläre Oszillationen: Uhren der Tiere?
Samstag, 14.12.24

Viele Nervenzellen sowie auch Zellen im Herzen zeigen intrinsisch oszillatorisches Verhalten auf einer Zeitskala von Millisekunden bis zu wenigen Sekunden. Damit diese Zellen aber im kollektiven Zusammenspiel physiologisch funktionale makroskopische Oszillationen erzeugen können, müssen sie aufeinander „hören“ können und ihre Oszillationsperioden aneinander anpassen. Der Vortrag verfolgt zum einen das Ziel, eine Vielzahl bekannter, aber auch einige weniger offensichtliche Oszillationen vorzustellen, die Tieren (und uns Menschen) eine subjektive Zeitwahrnehmung vermitteln könnten. Zum anderen soll ein grundlegendes mathematisches Prinzip der Synchronisation erklärt werden, das erklärt, was „aufeinander zu hören“ bedeutet und auch wie dieses Prinzip mechanistisch in Zellverbänden, Organen und sozialen Interaktionen implementiert wird.
Eduard C. Saluz
(ehem. Direktor, Deutsches Uhrenmuseum, Hochschule Furtwangen)
„Zu den Dingen selbst“ – Uhren und Zeitvorstellungen
Samstag, 21.12.24

Uhren zeigen uns nicht nur an, wie spät es ist, sie sind selbst Zeugnisse ihrer Zeit. Doch nicht nur das Äußere der Uhren und die Art ihrer Werke haben sich im Lauf der Zeit gewandelt, sondern auch das Messen und das Bezeichnen der Zeit. Diesem Wandel geht der Vortrag anhand von historischen Uhren, Bildern und Literaturzitaten nach. Wir werden sehen, wie sich auch für uns so selbstverständliche Fragen wie „Wann beginnt der Tag?“ oder „Wie lange dauert eine Stunde?“ historisch änderten. Natürlich gehen die Uhren im Lauf der Geschichte immer genauer, deswegen wurden sie aber nicht ‚besser‘, sondern nur anders. Von Beginn an erfüllten die Uhren perfekt die Bedürfnisse ihrer Benutzer – und weckten neue. Dies zu entdecken bedarf weniger Fachwissen als vorurteilsfreier Betrachtung. Lassen wir die Uhren also selber sprechen, gehen wir mit Edmund Husserl „zu den Dingen selbst“!
Prof. Dr. Onno Oncken
(Fachbereich Geowissenschaften, FU Berlin/ Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum)
Stein und Zeit: Die langen Zeitachsen der Erdgeschichte – Lehren für die Zukunft?
Samstag, 11.01.25

Der Blick des Menschen auf die Erde und ihre Geschichte wird von seinem Wahrnehmungshorizont und den Eigenschaften des Gedächtnisses der Erde geprägt. Dieser Blick auf die geologischen Zeiten hat in den vergangenen zwei Jahrhunderten eine vielfältige Entwicklung genommen: Von der Vorstellung eines biblischen Erdalters von wenigen Jahrtausenden über die Argumente des Aktualismus zur Beständigkeit geologischer Prozesse – die ein hohes Erdalter erfordern – bis zur Entdeckung der Radioaktivität und der Eröffnung der geochronologischen Datierung des in Gesteinen festgehaltenen Gedächtnisses. Heute bestimmen Vorstellungen über Prozessraten und Wechselwirkungen unser Verständnis des Erdsystems. Menschliche Wahrnehmungsfähigkeit hat aber zugleich Grenzen, ob es um die langen Zeitachsen geht und das dynamische Geschehen in einem erstaunlich engen Fenster, das biologisches Leben seit rund 4 Milliarden Jahren ermöglicht, oder um die Gegenwart mit dem Thema Naturgefahren und ihren Eintretenswahrscheinlichkeiten in der Zukunft, das uns bis heute überfordert.
PD Dr. Fernando Esposito
(Historisches Seminar, Abt. Neuere und Neueste Geschichte, Universität Münster)
Moderne Zeiten. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie historischer Zeiten
Samstag, 18.01.25

Entgegen landläufigen Annahmen hat auch die Zeit eine Geschichte. Zeit, so die Grundannahme, ist kein apriorisches Datum. Sie ist also keineswegs natürlich und gegeben, sondern ein historisches Faktum – sie wird von uns Menschen hervorgebracht und ist ihrerseits historischem Wandel unterworfen. Nicht die Zeit der Physiker:innen und der Atomuhren steht hier im Zentrum des Interesses, als vielmehr die Zeiten der Gesellschaft. Und nirgendwo wird deren Wandel greifbarer als im Zukunftsschwund, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Die Moderne, so Reinhart Kosellecks These, zeichnete sich durch eine Neue Zeit aus, die sich zwischen 1750 und 1850 einstellte. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde diese Neue Zeit indes einer wachsenden Zahl von Zeitgenoss:innen immer fragwürdiger. Der Vortrag spürt der Entdeckung der Geschichtlichkeit der Zeit wie ihrem Wandel nach und fragt nach den Konsequenzen für die Gesellschaft wie für die Geschichtswissenschaft.
Dr. Johannes Graf
(stv. Direktor, Deutsches Uhrenmuseum, Hochschule Furtwangen)
Kuckucksuhr, mon amour: Zur Kulturgeschichte eines Souvenirs zwischen Trash und Kult
Dienstag, 21.01.25 | 20 Uhr c.t., HS 1010

Sei es in Berlin, Neuschwanstein, Rüdesheim oder in Freiburg - in jedem gut sortierten Andenkengeschäft kann man Kuckucksuhren kaufen. Bis heute zählen sie zu den beliebtesten Souvenirs made in Germany. Was die wenigsten wissen: Die Uhr mit dem markanten Vogelruf blickt auf eine fast dreihundertjährige Geschichte zurück. Die Schwarzwälder Kuckucksuhr hat alle Wirren der Zeit und auch den Niedergang der heimischen Uhrenindustrie überlebt. Sie hat sich dabei immer wieder neu erfunden. Der Vortrag spannt einen großen Bogen von den ersten Exemplaren aus Holz über das klassische Bahnhäusle-Design mit den geschnitzten Vorderfronten bis hin zu der Frage, was Homer Simpson mit der Kuckucksuhr zu tun hat.
Prof. Dr. Anne Holzmüller
(Musikwissenschaftliches Institut, Philipps-Universität Marburg)
Anfang und Ende, Pfeil und Kreis, Pausen und Klicks: Perspektiven auf Musik als Zeitkunst
Samstag, 25.01.25

Aufgrund ihres Verlaufscharakters gilt Musik als die Zeitkunst schlechthin und, umgekehrt, ihre Zeitlichkeit als die dominante Qualität von Musik. Das macht den Zusammenhang jedoch alles andere als banal, im Gegenteil: Ihre Zeitlichkeit ist maßgeblich für den existenziellen Charakter verantwortlich, den man Musik traditionell beimisst. Der Vortrag soll sich dem Zusammenhang aber nicht allein aus diesem existenziellen Blickwinkel widmen, sondern ihn zunächst aus ideengeschichtlicher und ästhetischer Perspektive in den Blick nehmen; weiter sollen verschiedene Modelle des kompositorischen Umgangs mit Zeit diskutiert und schließlich einige systematische Überlegungen darüber angestellt werden, welche Aspekte der Zeitlichkeit auch unsere alltäglichen Praktiken im Umgang mit Musik – Praktiken des Aufführens oder Musizierens, aber auch des Hörens, des Aufnehmen oder Abspielens von Musik – bestimmen.
Prof. Dr. Dennis Lehmkuhl
(Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Natur- und Wissenschaftsphilosophie, Universität Bonn)
Sind Zeitreisen möglich?
Samstag, 01.02.25

Ob nun H.G. Wells, Star Trek oder Harry Potter: Zeitreisen spielen in Literatur und Film eine große Rolle und sind häufig der Aufhänger für die spannendsten Geschichten. Aber sind sie auch physikalisch möglich? Es ist unbestritten, dass es uns technologisch noch nicht möglich ist, durch die Zeit zu reisen, aber ist dies durch die Naturgesetze, soweit sie uns bekannt sind, zumindest im Prinzip möglich? Der Vortrag wird zunächst zwischen unterschiedlichen Arten von Zeitreisen, wie sie in Film und Literatur vorkommen, unterscheiden, um dann mit Blick auf Einsteins allgemeine Relativitätstheorie zu diskutieren, welche Arten von Zeitreisen zumindest im Prinzip möglich sind – und welche nicht.
Prof. Dr. Werner Frick
(Deutsches Seminar, Abt. Neuere Deutsche Literatur, Universität Freiburg)
Vom Werden und Vergehen: Zeitexperimente in der Literatur der klassischen Moderne
Samstag, 08.02.25
 Temporale Abläufe aller Art, Prozesse im unaufhaltsam fließenden Rhythmus des Werdens und Vergehens spielen auch in den kunstvoll arrangierten Texten der Literatur eine dominante Rolle, in allen literarischen Gattungen (Epik, Dramatik, Lyrik) kann der Parameter ‚Zeit‘ zentrale Bedeutung gewinnen, und dies auf der Ebene der poetischen Form und Darstellung ebenso wie als Thema und Problemgehalt literarisch-fiktionaler ‚Welten‘ und ihrer der Zeitlichkeit unterworfenen Protagonisten. Eine ganz besondere Prominenz haben Zeitreflexionen im Erzählen der klassischen Moderne erlangt, also in jenen großen Romanen des frühen 20. Jahrhunderts von Autoren wie Marcel Proust, Thomas Mann, Alfred Döblin, Robert Musil, Franz Kafka, James Joyce oder Hermann Broch, die in sehr unterschiedlicher Weise um das Thema ‚Zeit‘ kreisen und kühne experimentelle Darstellungsformen für seine existentiellen Herausforderungen und Aporien gefunden haben. An ausgewählten Beispielen wird der Vortrag in diesen Kosmos narrativer Zeitgestaltungen einführen und nach ihren ideen- und kulturgeschichtlichen Kontexten ebenso fragen wie nach der spezifischen Erkenntnisfunktion literarischer Zeitrepräsentationen.
Temporale Abläufe aller Art, Prozesse im unaufhaltsam fließenden Rhythmus des Werdens und Vergehens spielen auch in den kunstvoll arrangierten Texten der Literatur eine dominante Rolle, in allen literarischen Gattungen (Epik, Dramatik, Lyrik) kann der Parameter ‚Zeit‘ zentrale Bedeutung gewinnen, und dies auf der Ebene der poetischen Form und Darstellung ebenso wie als Thema und Problemgehalt literarisch-fiktionaler ‚Welten‘ und ihrer der Zeitlichkeit unterworfenen Protagonisten. Eine ganz besondere Prominenz haben Zeitreflexionen im Erzählen der klassischen Moderne erlangt, also in jenen großen Romanen des frühen 20. Jahrhunderts von Autoren wie Marcel Proust, Thomas Mann, Alfred Döblin, Robert Musil, Franz Kafka, James Joyce oder Hermann Broch, die in sehr unterschiedlicher Weise um das Thema ‚Zeit‘ kreisen und kühne experimentelle Darstellungsformen für seine existentiellen Herausforderungen und Aporien gefunden haben. An ausgewählten Beispielen wird der Vortrag in diesen Kosmos narrativer Zeitgestaltungen einführen und nach ihren ideen- und kulturgeschichtlichen Kontexten ebenso fragen wie nach der spezifischen Erkenntnisfunktion literarischer Zeitrepräsentationen.
Mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Freiburg und der Badischen Zeitung